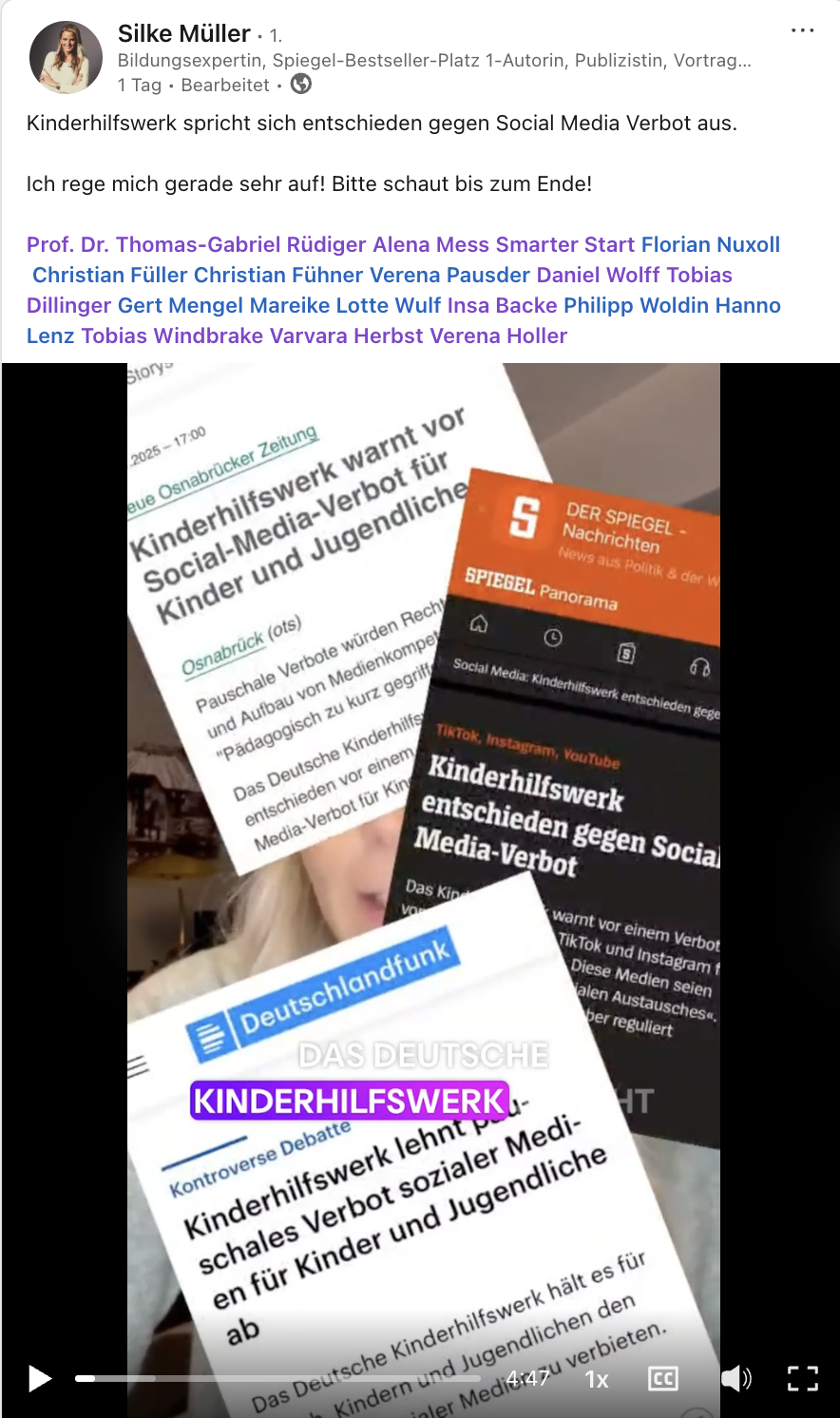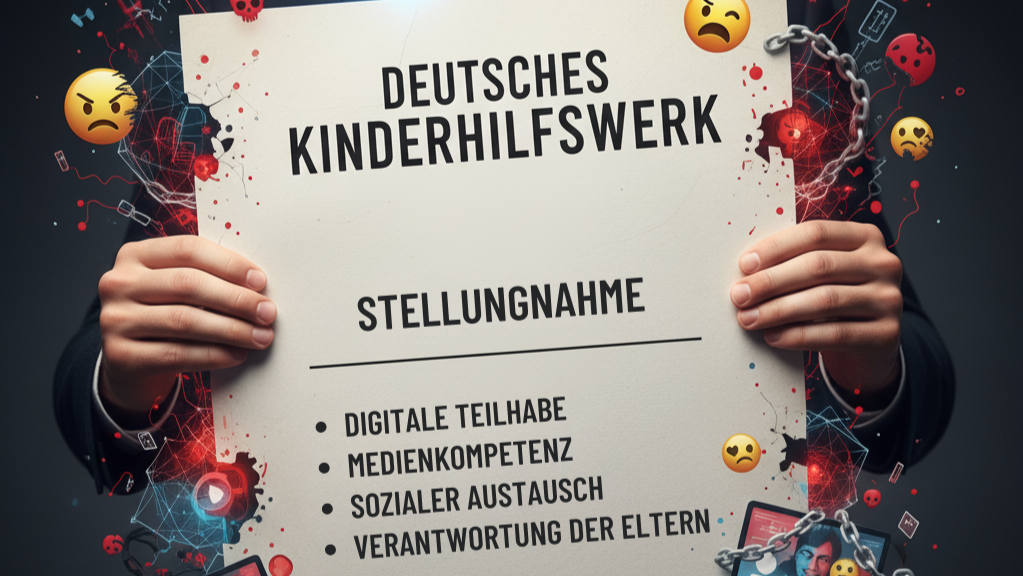Nicht zu fassen: Kinderhilfswerk spricht sich gegen Social Media Verbot für Kinder aus
Als Elternteil liest man die Stellungnahme des Deutschen Kinderhilfswerks und fragt sich im ersten Moment, ob es ein schlechter Witz ist. Ausgerechnet die Organisation, die den Schutz von Kindern im Namen trägt, warnt ernsthaft vor einem allgemeinen Social Media Verbot für Kinder und Jugendliche. Verbote seien entmündigend, Kinder hätten ein Recht auf digitale Teilhabe, Medienkompetenz sei der richtige Weg. Auf dem Papier klingt das nach moderner Pädagogik. In der Realität der Kinder wirkt es wie eine Argumentation aus einem Paralleluniversum.
Denn während in solchen Stellungnahmen über Teilhabe philosophiert wird, sehen Kinder auf ihren Handys Foltervideos, Hardcore Pornografie, Suizid-Inhalte, Erniedrigung, Hass und Erpressung. Jeden Tag, jede Nacht, mitten in Kinderzimmern und Schulfluren. Viele Eltern kämpfen mit panischen Kindern, zerstörtem Selbstbild, Schlafstörungen und digitaler Gewalt. Und dann kommt eine Kinderrechtsorganisation und erklärt, das eigentliche Problem seien pauschale Verbote und ein zu starkes Schutzdenken.
Versuchen wir, das einzuordnen.
Bild generiert mit Hilfe von KI (ChatGPT/DALL·E, OpenAI)
Was das Kinderhilfswerk sagt
Das Kinderhilfswerk stellt drei Punkte in den Vordergrund.
Erstens: Pauschale Verbote von Social Media für Kinder und Jugendliche seien ungeeignet. Sie würden Kinder entmündigen, ihrem Recht auf digitale Teilhabe widersprechen und den Aufbau von Medienkompetenz verhindern.
Zweitens: Soziale Medien seien für junge Menschen ein wichtiger Ort für sozialen Austausch, Zugehörigkeit und Freizeit. Ein Verbot würde Kommunikationswege abschneiden und gerade Kinder aus bildungsfernen Familien zusätzlich benachteiligen.
Drittens: Statt Verboten brauche es bessere Regulierung, eine Stärkung der Medienerziehung und Eltern, die ihre Kinder früh und kompetent begleiten.
Auf den ersten Blick klingt das vernünftig. Niemand hat etwas gegen gute Medienbildung. Niemand will Kindern sinnvolle digitale Angebote wegnehmen. Das Problem ist nur: Diese Stellungnahme klingt so, als würde sie aus einer Welt stammen, in der Kinder ein bisschen chatten, ein paar Tanzvideos schauen und nebenbei lernen, wie man ein sicheres Passwort setzt. In dieser Welt leben unsere Kinder aber längst nicht mehr…
Wie sich die Realität im Kinderzimmer anfühlt
Wer mit Kindern und Jugendlichen lebt oder arbeitet, sieht ein anderes Bild.
Kinder sehen auf ihren Handys Gewaltvideos, Erniedrigung, Pornografie, Mobbing, Hass und Verschwörungsbotschaften. Nicht selten, sondern ständig. Dazu Druck durch Klassenchats, Kettenbriefe, Nacktbilder, Screenshots, die nie wieder verschwinden.
Viele Kinder schlafen schlecht, haben Angst, schämen sich für Bilder, die sie verschickt haben. Manche trauen sich nicht, ihren Eltern von dem zu erzählen, was passiert ist.
Wir Eltern sitzen abends neben einem Kind, das zittert und weint, weil im Klassenchat ein Video geteilt wurde, das es nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Wir sitzen neben einem Kind, das auf einmal nicht mehr ins Schwimmbad möchte, weil jemand seinen Körper kommentiert hat. Wir sitzen neben einem Kind, das panisch wird, wenn das Handy zur Seite gelegt werden soll.
Und dann lesen wir eine Stellungnahme, in der die große Sorge ist, dass ein Verbot von Social Media für Kinder ihre Teilhabe einschränkt.
Es fühlt sich an, als würde jemand vor einer vierspurigen Schnellstraße stehen, auf der Kinder ohne Schutz herumrennen, und sagen “Das Wichtigste ist, dass sie lernen, wie Verkehr funktioniert”.
Natürlich sollen Kinder irgendwann lernen, mit Gefahren umzugehen. Aber niemand würde ernsthaft vorschlagen, Grundschulkinder alleine auf eine Schnellstraße zu schicken, damit sie Verkehrskompetenz üben.
Was Silke Müller aus dem Schulalltag sieht
Wer Silke Müller zuhört, bekommt ein anderes Bild. Sie arbeitet seit Jahren mitten in diesem Spannungsfeld, jeden Tag, mit Kindern, Eltern und Lehrkräften.
Dieses Video hat sie als Antwort auf die Pressemeldung veröffentlicht:
Link zum LinkedIn Beitrag von Silke Müller
Sie berichtet von Jugendlichen, die in ihren Feeds Folterbilder, entwürdigende Pornografie, Tierquälerei, brutale Gewalt und Hassbotschaften sehen. Nicht einmal im Jahr, sondern ständig. Sie erzählt von Cybergrooming, von Erpressung mit Nacktbildern, von Kindern, die nachts nicht mehr schlafen, weil die Bilder in ihrem Kopf bleiben.
Vor dieser Realität wirken die Sätze vom wichtigen Ort des Austauschs seltsam abstrakt. Ja, natürlich gibt es auch harmlosen und positiven Content. Natürlich gibt es Inspiration, Austausch, Gemeinschaft. Aber die dunkle Seite ist so massiv, dass sie sich nicht mit ein paar allgemeinen Sätzen zu Teilhabe weg erklären lässt.
Silke Müller beschreibt Schulen, in denen Sozialarbeiter und Lehrkräfte versuchen, die Folgen einzufangen. Klassenchats, in denen sich Gewaltvideos stapeln. Kinder, die morgens wie betäubt in der Schule sitzen, weil sie halbe Nächte durch Feeds gescrollt haben. Mädchen, die kaum noch in den Spiegel schauen, weil ihr Selbstbild von Filtern und extremen Schönheitsidealen zerfressen wird. Diese konkrete Praxis kommt in der Stellungnahme des Kinderhilfswerks praktisch nicht vor.
Die besondere Verantwortung von Verbänden wie dem Kinderhilfswerk
Silke Müller erinnert im Video auch daran, dass es nicht reichen wird, wenn engagierte Einzelpersonen und einige Schulen versuchen gegenzuhalten, während große Organisationen und Politik die Debatte weichzeichnen.
Kinderrechtsorganisationen haben eine besondere Rolle. Sie könnten sehr deutlich sagen:
Kinderrechte gelten auch gegen wirtschaftliche Interessen. Schutzpflichten enden nicht am Rand des Bildschirms. Wir erwarten von der Politik klare Altersgrenzen, scharfe Durchsetzung und Strukturen, die Eltern entlasten, statt ihnen die gesamte Verantwortung zuzuschieben.
Stattdessen entsteht in der jetzigen Stellungnahme des Kinderhilfswerks der Eindruck, dass Eltern und Schulen noch mehr begleiten und befähigen sollen, während die Systeme im Kern unangetastet bleiben. Genau das entspricht nicht dem, was Kinder in dieser Situation brauchen.
Kinderrechte sind nicht nur Teilhabe, sondern auch Schutz
Das Kinderhilfswerk beruft sich auf die Kinderrechtskonvention. Kinder hätten ein Recht auf digitale Teilhabe. Das stimmt.
Aber die Kinderrechtskonvention sagt noch etwas anderes. Sie sagt, dass Kinder ein Recht auf Schutz vor Gewalt, Ausbeutung, Missbrauch und schädlichen Inhalten haben. Und sie sagt sehr klar, dass wir Erwachsenen dafür verantwortlich sind. Eltern, Fachkräfte, Politik und natürlich auch Organisationen wie das Kinderhilfswerk.
Wenn in einer Stellungnahme fast nur von Teilhabe die Rede ist und kaum von Schutz, dann kippt etwas. Dann klingt es so, als sei der Zugang das Wichtigste und alles andere eine Frage von Bildung und Medienkompetenz.
Ehrlich wäre zu sagen: Kinder haben ein Recht auf digitale Teilhabe. Kinder haben ein genauso starkes Recht darauf, vor toxischen Plattformen geschützt zu werden. Beides zusammen gehört zu Kinderrechten. Nicht nur das eine.
Bild generiert mit Hilfe von KI (Gemini, Google)
Der erstaunliche Unterschied bei Kinderfotos und Influencer Kindern
Beim Thema Kinderfotos und Kinder als Influencer ist das Kinderhilfswerk sehr viel klarer.
Dort heißt es:
Kinder können die Folgen nicht überblicken.
Eltern und Agenturen haben oft eigene Interessen.
Plattformen verdienen an Klicks und Aufmerksamkeit.
Also brauche es strenge Vorgaben. Ein Gutachten, das das Kinderhilfswerk unterstützt, fordert etwa ein Verbot, Kinderfotos zu kommerziellen Zwecken zu posten, solange die Kinder sehr jung sind.
Die Logik dahinter ist richtig. Kinder können die Folgen nicht überblicken. Erwachsene entscheiden nicht immer im Sinne des Kindes. Plattformen verfolgen eigene wirtschaftliche Ziele. Also braucht es harte Leitplanken.
Nur: Warum gilt das beim Thema Kinderfotos und Werbung, aber nicht beim Thema Social Media Nutzung an sich? Denn all das stimmt auch dort.
Kinder können nicht einschätzen, was es bedeutet, wenn sie jahrelang auf Plattformen unterwegs sind, die alles messen, alles speichern und sie mit Inhalten fluten, die sie emotional überfordern. Plattformen tun alles, um Kinder möglichst früh zu binden und möglichst lange zu halten. Viele Eltern sind selbst unsicher oder überfordert.
Wenn man das ernst nimmt, müsste eine Kinderrechtsorganisation doch eigentlich sagen:
Ja, digitale Teilhabe. Aber in sicheren Räumen.
Ja, Medienkompetenz. Aber nicht als Ersatz für klare Altersgrenzen bei Hochrisiko Plattformen mit algorithmischen Feeds, Direktnachrichten und Livestreams.
Stattdessen warnt das Kinderhilfswerk vor Verboten und spricht von Entmündigung. Für viele Eltern wirkt das wie blanker Hohn.
Medienkompetenz ist wichtig, aber sie kann das gerade nicht alleine tragen
Ein Satz zieht sich durch die Stellungnahme: Wir brauchen Medienbildung, nicht Verbote. Da können wir alle mitgehen. Natürlich brauchen Kinder und Eltern Medienkompetenz. Natürlich brauchen wir Schulen, die das Thema ernst nehmen.
Aber reicht das, so wie die Lage jetzt ist?
Heute ist Medienbildung an vielen Schulen ein Nebenthema. Es gibt tolle Projekte und engagierte Lehrkräfte. Aber es gibt kein flächendeckendes Konzept. Viele Eltern hängen selbst in ihren Feeds fest, arbeiten zu viel oder fühlen sich überfordert von der Geschwindigkeit der digitalen Welt. Gleichzeitig werden die Plattformen jeden Tag besser darin, Aufmerksamkeit zu fressen. Sie testen, was Kinder möglichst lange hält. Sie spielen immer wieder mit denselben psychologischen Tricks.
In dieser Situation Medienkompetenz als Hauptlösung zu verkaufen, wirkt auf viele Eltern wie ein schlechter Scherz. Es ist, als würde man sagen, wir schaffen die Altersgrenze für Alkohol ab und setzen ausschließlich auf Aufklärung.
Niemand würde das ernsthaft fordern. Wir wissen, dass Aufklärung wichtig ist. Aber wir wissen auch, dass klare Grenzen nötig sind. Bei Social Media scheinen diese einfachen Erkenntnisse plötzlich nicht mehr zu gelten.
Das falsche “Entweder-Oder”
In der Stellungnahme klingt es so, als müssten wir uns entscheiden.
Entweder Verbote oder Medienkompetenz. Entweder Schutz oder Teilhabe. Dabei wissen alle, die mit Kindern arbeiten oder eigene Kinder haben, es braucht beides.
Kinder brauchen Vorbereitung und Begleitung. Und sie brauchen Erwachsene, die sagen: Bestimmte Räume sind in einem bestimmten Alter noch nicht für dich gemacht.
Kein Mensch käme auf die Idee, ein Kind in eine Spielhalle zu setzen und zu sagen: Dort lernst du am besten, wie man mit Glücksspiel umgeht. Aber genau diese Logik steckt in der Kritik an Verboten für junge Kinder. Als müssten sie mitten in die problematischsten Räume hinein, um dort Medienkompetenz zu lernen.
Wie sich die Argumente wie Sätze der Plattformen anhören
Noch etwas macht viele Eltern misstrauisch. Die Argumentation des Kinderhilfswerks klingt an vielen Stellen ähnlich wie die Argumente der Plattformen selbst.
Kinder seien Teil der digitalen Gesellschaft.
Sie müssten früh lernen, sich zu orientieren.
Die Lösung sei Bildung, nicht Begrenzung.
Eltern und Schulen seien verantwortlich.
Das alles stimmt formal. Aber tragen die Betreiber der Plattformen keine Verantwortung? Und übersehen wir hier nicht einen wichtigen Punkt. Diese Systeme sind nicht neutral, sie sind Geschäftsmodelle!
Je mehr Kinder sie nutzen, desto besser für die Plattform. Je länger sie bleiben, desto wertvoller werden sie als Zielgruppe.
Wenn eine Kinderrechtsorganisation so argumentiert, wirkt es, als würde sie den Blick der Plattformen übernehmen. Kinder sind dann vor allem Nutzer, die etwas lernen sollen. Nicht in erster Linie Menschen, deren Schutz und Würde an erster Stelle stehen muss. Am Ende rechtfertigt das ungewollt genau das System, das unsere Kinder gerade überfordert.
Digitale Teilhabe ist mehr als TikTok und Instagram
Ein weiteres Problem in dieser Debatte ist die “Digitale Teilhabe”. Diese wird so dargestellt, als ginge es vor allem um große Social Media Plattformen.
Aber digitale Teilhabe ist viel mehr. Sie bedeutet zum Beispiel Lernplattformen, Klassenchats mit guten Regeln, sichere Messenger, kreative Projekte, Coding, Online Beteiligung in der Kommune, Jugendangebote mit klaren Schutzkonzepten.
Kinder können digital teilhaben, ohne schon mit zehn, elf oder zwölf Jahren in den globalen Feeds der großen Konzerne zu landen. Wenn wir so tun, als sei ein Social Media Verbot für Kinder gleichbedeutend mit digitaler Ausgrenzung, haben die Plattformen die Diskussion bereits gewonnen.
Was die Reaktionen auf die Kritik zeigen
Unter den LinkedIn-Beiträgen, die die Stellungnahme des Kinderhilfswerks kritisieren, melden sich vor allem Menschen, die täglich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten.
Lehrkräfte.
Schulsozialarbeiterinnen.
Psychologinnen.
Jugendhilfe.
Eltern.
Viele schreiben, dass sie froh sind, endlich Worte zu haben für das, was sie seit Jahren sehen. Gewaltvideos in Klassenchats. Essstörungen, die durch Filter und Schönheitsideale angeheizt werden. Erpressung mit intimen Fotos. Kinder, die nicht mehr wissen, wie sie aus dieser Welt wieder herauskommen sollen.
Andere erzählen, wie einsam sie sich als Eltern fühlen. Sie versuchen, vernünftige Grenzen zu setzen, werden aber als übertrieben dargestellt. Wenn dann noch eine große Organisation wie das Kinderhilfswerk vor Verboten warnt, fühlen sie sich komplett im Regen stehen gelassen.
Das alles sind keine theoretischen Fälle. Das ist der Alltag in Familien, Schulen und Beratungsstellen.
Bild generiert mit Hilfe von KI (ChatGPT/DALL·E, OpenAI)
Was Eltern aus dieser Debatte ziehen dürfen
Viele Eltern trauen sich kaum zu sagen, dass sie Social Media für Kinder in der Grundschule oder in der frühen Pubertät für eine sehr schlechte Idee halten. Sie haben Angst, altmodisch zu wirken. Angst, ihre Kinder auszuschließen. Angst, gegen „Expertenmeinungen“ zu stehen.
Mit diesem Artikel möchten wir dir als Mutter oder Vater etwas anderes sagen:
Du darfst dein Kind schützen!
Du darfst klare Grenzen setzen!
Du darfst Social Media für dein Kind eine Zeit lang nein nennen und trotzdem für digitale Teilhabe sein!
Du darfst von Politik und Verbänden mehr erwarten, als schöne Worte über Medienkompetenz.
Du darfst fordern, dass Plattformen so gebaut werden, dass Kinder dort nicht kaputtgehen.
Und du darfst von einer Kinderrechtsorganisation verlangen, dass sie Kinderrechte ganz liest. Mit Teilhabe. Und mit Schutz.
Fazit
Am Ende bleibt ein bitterer Eindruck. Das Deutsche Kinderhilfswerk weiß sehr genau, wie verletzlich Kinder sind und wie brutal die digitale Welt sein kann. Es warnt vor Kinderfotos im Netz, vor Influencer Kindern, vor Ausbeutung. Aber bei der Frage, ob Kinder überhaupt in diese Social Media Räume gehören, zieht es sich plötzlich auf schöne Worte über Teilhabe und Medienkompetenz zurück. Das ist nicht nur schwer nachvollziehbar. Es ist gefährlich.
Wer Kinderrechte ernst nimmt, kann in dieser Situation nicht so tun, als gehe es vor allem darum, Verbote zu vermeiden. Unsere Kinder werden nicht daran scheitern, dass wir sie eine Weile von TikTok und Instagram fernhalten. Sie scheitern daran, dass wir sie zu früh in Systeme schicken, die sie überfordern, krank machen und beschämen. Kinderrechte bedeuten nicht nur Zugang, sondern auch Schutz. Nicht nur Unterricht über Risiken, sondern auch klare Grenzen dort, wo Risiken außer Kontrolle geraten sind.
Viele Eltern spüren das längst. Sie sehen, was auf den Bildschirmen ihrer Kinder passiert, und fühlen sich von Politik und Verbänden im Stich gelassen. Das darf eine Kinderrechtsorganisation nicht einfach hinnehmen. Sie müsste an der Seite dieser Eltern stehen und laut sagen: Ja, digitale Teilhabe. Aber nein, nicht um jeden Preis und nicht in jedem Raum. Kinder zuerst, Plattformen danach. Genau dieses klare Signal fehlt in der aktuellen Stellungnahme. Und genau deshalb müssen wir es als Eltern jetzt selbst aussprechen.