Medien im Familienalltag: Tipps für Eltern.
Gastbeitrag von Maja Sommer
Unsere Gesellschaft ist im Umbruch. Als Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin beobachte ich das intensiv und spreche mit Jugendlichen darüber. Ich frage sie, wie es ihnen geht, was sie erleben und was sie brauchen. Wenn eine Antwort kommt wie “es juckt mich nicht mehr”, dann frage ich weiter. Was passiert mit einer Gesellschaft, in der Mitgefühl verloren geht und in der Kinder abstumpfen?
Kinder wachsen heute in einer digitalen Welt auf, in der ihr erster Kontakt mit Sexualität immer seltener über Gespräche, Bücher oder Beziehungen entsteht. Stattdessen übernehmen Algorithmen diese Rolle. Algorithmen in sozialen Medien, die nicht auf Schutz, Entwicklung oder Fürsorge ausgelegt sind, sondern auf maximale Aufmerksamkeit und Verweildauer.
Gastbeitrag von Marieke Jung
Schon mal von Skibidi Toilets gehört? Diese Köpfe, die aus Toiletten kommen wie geisteskranke Zombies, deren Anblick einen unwillkürlich am menschlichen Verstand, an Sitte und Moral der Entwickler zweifeln lässt, gehören in vielen deutschen Grundschulen heute neben Fortnite und anderen viralen Phänomenen zum Alltag.
Gastbeitrag von Varvara Herbst, Diplom-Psychologin.
Kinder machen bei Challenges mit, weil sie „mit der Herde schwimmen“ wollen? Weil sie Aufmerksamkeit brauchen? Weil „die Jugend heutzutage halt so ist“? Hinter vielen Challenges stecken ganz normale menschliche Bedürfnisse – nur eben im Turboformat der digitalen Welt: Gesehen werden. Anerkennung. Sich lebendig fühlen. Sich messen. Dazugehören.
Heiligabend ist vorbei. Unter vielen Weihnachtsbäumen lagen Smartphones, Spielkonsolen, Tablets oder neue Games. Für Kinder ist das ein riesiges Geschenk – genau jetzt ist der richtige Moment, dich mit Kinderschutzeinstellungen zu beschäftigen. Nicht später, nicht irgendwann, sondern jetzt. Solange alles noch neu ist und Regeln selbstverständlich wirken.
Gastbeitrag von Julia von Weiler
Digitale Räume gehören längst zu unserem Alltag – und folgen doch eigenen Regeln. Was wir analog intuitiv wahrnehmen, fehlt digital: Tonfall, Blickkontakt, Pausen, all die kleinen Signale, die helfen, Situationen einzuordnen. Stattdessen bestimmen Tempo, Sichtbarkeit und algorithmische Verstärkung die Kommunikation. Das überfordert Kinder – und oft genauso Erwachsene.
Gastbeitrag von Maja Sommer
Kinder und Jugendliche wachsen in einer Welt auf, die komplexer ist, als viele Erwachsene es sich vorstellen. Sie sind täglich online, treffen dort Entscheidungen, sehen Inhalte, folgen Empfehlungen und geraten in Situationen, die sie oft nicht einordnen können. Was ihnen fehlt, ist nicht nur Medienwissen, sondern ein Raum, in dem sie über all das sprechen dürfen.
Gastbeitrag von Varvara Herbst, Diplom-Psychologin.
Wir Menschen wollen etwas schaffen, Kinder ganz besonders. Sie wollen ausprobieren, sich weiterentwickeln, Fähigkeiten aufbauen und erleben ”Ich kann etwas selbst bewirken”. Nicht, weil wir es von ihnen erwarten, sondern weil es ein Grundbedürfnis ist: Selbstwirksamkeit. Doch genau dieses Gefühl geht heute immer häufiger verloren. Nicht, weil Kinder weniger motiviert wären. Sondern weil digitale Plattformen Mechanismen nutzen, die Kinder in den Konsummodus ziehen, statt ins eigene Gestalten.
Kinder gehören nicht ins Internet! Und schon gar nicht in dem Ausmass, wie wir es heute sehen. Es geht längst nicht mehr nur um Fotos. Heute werden Videos geteilt, Alltagsszenen gezeigt, Geschichten erzählt, Daten veröffentlicht und sogar die Stimmen von Kindern landen online. Oft gut gemeint, oft aus Stolz, manchmal aus Routine. Doch die Folgen tragen später nicht wir, sondern unsere Kinder.
Viele Eltern vertrauen darauf, dass ihr Kind mit der Anton-App lernt. Wir sehen ein Kind mit einem Tablet, wir hören den bekannten Anton-Ton, wir wissen, dass die Schule die App empfiehlt. Alles wirkt sinnvoll und harmlos. Doch in vielen Klassen passiert etwas völlig anderes. Kinder nutzen die Anton-App nicht zum Lernen, sondern zum Spielen. Und das bleibt oft unbemerkt. Der Grund dafür ist ein Trick, der sich seit Monaten in rasantem Tempo verbreitet. Es ist der sogenannte Coin Hack.
Gastbeitrag von Varvara Herbst, Diplom-Psychologin.
Kinder wollen erleben. Nicht nebenbei, nicht passiv, sondern richtig, mit allen Sinnen. Sie wollen lachen, gestalten, Neues ausprobieren und eintauchen. Kurz gesagt: Sie wollen Spiel & Spaß. Wenn sie also ans Gerät wollen, geht es oft einfach nur um einen schnellen Zugang zu Freude, Spannung und Flow. Und genau hier geraten Eltern unter Druck: Wir wollen unser Kind nicht dauernd „bespaßen“, aber wir wollen auch nicht, dass Langeweile automatisch in Bildschirmzeit endet.
Gastbeitrag von Varvara Herbst, Diplom-Psychologin. Wenn Kinder nach einem Smartphone fragen, geht es selten um das Gerät selbst, sondern um das Gefühl, verbunden zu sein: Mit Freunden, mit der Klasse, mit dem, was „alle“ gerade tun. Denn Kinder wollen einfach dazugehören. Sie wollen Teil der Gruppe sein, nicht außen vor. Wir Eltern stehen dabei oft im Spannungsfeld zwischen sozialem Druck, dem Wunsch nach Schutz und einer digitalen Welt, die sich schneller entwickelt, als wir mitkommen.
Viele Eltern und Kinder wissen eigentlich, dass es nichts umsonst gibt. Auch Apps und Spiele nicht. Hinter jeder App stehen Menschen, die Gehälter brauchen. Entwickler haben Familien, zahlen Miete und haben ganz normale Rechnungen. Irgendwoher muss also das Geld kommen.vIn der Regel kommt das Geld über Werbung, Käufe in der App oder aus dem Verkauf von Daten, die beim Nutzen der App entstehen. Genau hier beginnt das Problem.
Fotos vom ersten Schultag, das neue Fahrrad, ein Video vom Kindergeburtstag. Wir alle haben solche Momente schon geteilt. Oft aus Stolz, manchmal um Familie und Freunde teilhaben zu lassen. Doch was harmlos beginnt, hat einen Namen: Sharenting. Und es kann Folgen haben, die wir beim Posten kaum ahnen.
Früher war das ganz normal. Nach dem Sommerfest kam das Gruppenfoto auf die Schulhomepage, nach dem Turnier landete das Mannschaftsbild auf der Vereinsseite. Alle waren stolz, die Kinder haben gewunken, niemand hat sich Gedanken gemacht. Heute ist das anders. Das Internet vergisst nicht. Was einmal online ist, bleibt dort – oft für immer. Und die Welt, in der unsere Kinder groß werden, ist eine andere geworden.
„Darf ich in den Klassenchat?“ Fast alle von uns standen schon einmal an diesem Punkt. Es klingt harmlos, fast selbstverständlich. Doch wer einmal erlebt hat, was in solchen Chats wirklich passiert, weiß: Wir öffnen damit keine harmlose Spielwiese, sondern ein Tor zu einer Welt, die sie emotional oft überfordert.
Wir alle kennen das Gefühl: Das Kind lacht, hält stolz das Zeugnis in die Kamera oder springt voller Freude ins Meer. Und im selben Moment möchten wir diesen Augenblick teilen – mit Oma, den Freunden, der Familie.
Das ist menschlich. Wir wollen Nähe schaffen, zeigen, worauf wir stolz sind, und Menschen, die wir lieben, ein Stück am Familienleben teilhaben lassen. Aber: Das Internet ist kein privates Wohnzimmer UND was dort landet, bleibt selten privat.
Wir alle kennen das: Das Kind sagt „Gute Nacht“ – und wenig später leuchtet es noch unter der Bettdecke. Ein kurzer Blick auf TikTok, eine letzte Nachricht in der Klassengruppe oder ein Video auf YouTube. Immer mehr Erfahrungen und Studien zeigen: Das Handy im Bett ist ein echtes Problem für Kinder.
Viele Eltern vertrauen darauf, dass Spotify eine sichere Umgebung für ihre Kinder ist: Hörspiele, Musik, Podcasts – was soll da schon passieren? Doch die Wahrheit ist unbequem: Spotify ist keine kindersichere Plattform.
Eltern denken oft, ein Klassenchat sei praktisch: Die Kinder könnten Hausaufgaben austauschen, sich zum Spielen verabreden, wichtige Infos landen schnell bei allen. In der Realität sind Klassenchats aber selten ein Ort der Organisation – sie sind ein Ort des Chaos, der Konflikte und leider auch des Mobbings.
„Alle anderen dürfen das!“ – kaum ein Satz bringt Eltern so zuverlässig in die Bredouille wie dieser. Und fast immer geht es um digitale Themen: das erste Smartphone, WhatsApp, Instagram, ein Spiel auf dem Handy oder eine App, die eigentlich erst ab 16 ist. Kinder und Jugendliche vergleichen sich ständig mit Gleichaltrigen – und für Eltern bedeutet das: erklären, begründen, aushalten. Doch wie geht man mit solchen Situationen gut und souverän um?
Digitale Medien sind längst fester Bestandteil unseres Familienlebens – vom Hörspiel auf dem Smart Speaker bis zur ersten eigenen App auf dem Smartphone. Doch viele Eltern stellen sich früher oder später die gleiche Frage: Wie viel Bildschirmzeit ist okay? Und welche Regeln helfen wirklich – im Alltag, nicht nur auf dem Papier?
Ein eigenes Smartphone verändert die Kindheit – und zwar grundlegend. Viele Eltern spüren das intuitiv, aber im Alltag fällt es schwer, konsequent zu bleiben. Schließlich "haben alle eins" – oder? Doch je früher Kinder ein Smartphone bekommen, desto größer ist das Risiko, dass wichtige Entwicklungsschritte auf der Strecke bleiben. Studien zeigen: Die Geräte sind mehr als nur praktische Alltagshelfer. Sie beeinflussen, wie Kinder denken, fühlen, lernen – und wie sie sich selbst sehen.
Wer Social Media nutzt – also Instagram, TikTok, YouTube oder Snapchat – kommt an einem Begriff nicht vorbei: dem Algorithmus. Für viele klingt das nach komplizierter Technik oder nach etwas, das man ohnehin nicht versteht. Dabei lässt sich das Prinzip ganz einfach erklären – und es ist wichtig, dass wir Eltern (und auch wir selbst) verstehen, wie diese Systeme funktionieren. Denn der Algorithmus entscheidet maßgeblich mit, was unsere Kinder – und wir selbst – täglich sehen.
Smartphones, Social Media, Gaming – unsere Kinder sind digital längst unterwegs. Für uns Eltern bedeutet das: neugierig bleiben, Fragen stellen, begleiten statt verbieten. Der Bildschirm ist für viele Kinder längst zum ständigen Begleiter geworden – beim Spielen, beim Lernen, manchmal sogar beim Einschlafen. Was für die einen selbstverständlich zum Alltag gehört, wird für andere zur Belastung.
Viele Eltern nutzen die Kindersicherungen auf dem Smartphone, um ihre Kinder zu schützen: Bildschirmzeit begrenzen, bestimmte Apps sperren oder das Handy abends automatisch abschalten. Das ist gut und wichtig – aber leider nicht immer sicher.
Die Diskussion über ein Smartphoneverbot an Schulen ist in vollem Gange. Immer wieder wird gefordert, Geräte ganz aus dem Unterricht zu verbannen. Doch bei dieser Debatte geht es oft mehr um Kontrolle als um Orientierung. Wir möchten das Thema aus einer anderen Perspektive betrachten – und über Vertrauen, Aufklärung und gute Gewohnheiten sprechen. Denn nur gemeinsam mit Kindern, Eltern und Schulen lassen sich Lösungen finden, die langfristig tragen.
Das erste Smartphone ist für Grundschulkinder ein spannender Schritt – aber auch eine Herausforderung. Plötzlich gibt es unendliche Unterhaltungsmöglichkeiten auf Knopfdruck. Doch gerade deshalb sind digitale Pausen so wichtig. Sie helfen Kindern, den Blick vom Bildschirm zu lösen und bewusst Zeit ohne Smartphone zu erleben.
Viele Eltern machen sich Gedanken darüber, wie viel Zeit ihre Kinder am Smartphone verbringen – aber was ist mit der eigenen Nutzung? Immer mehr Studien zeigen, dass nicht nur Kinder durch digitale Medien beeinflusst werden, sondern auch ihr Umfeld – insbesondere durch das Verhalten der Eltern.

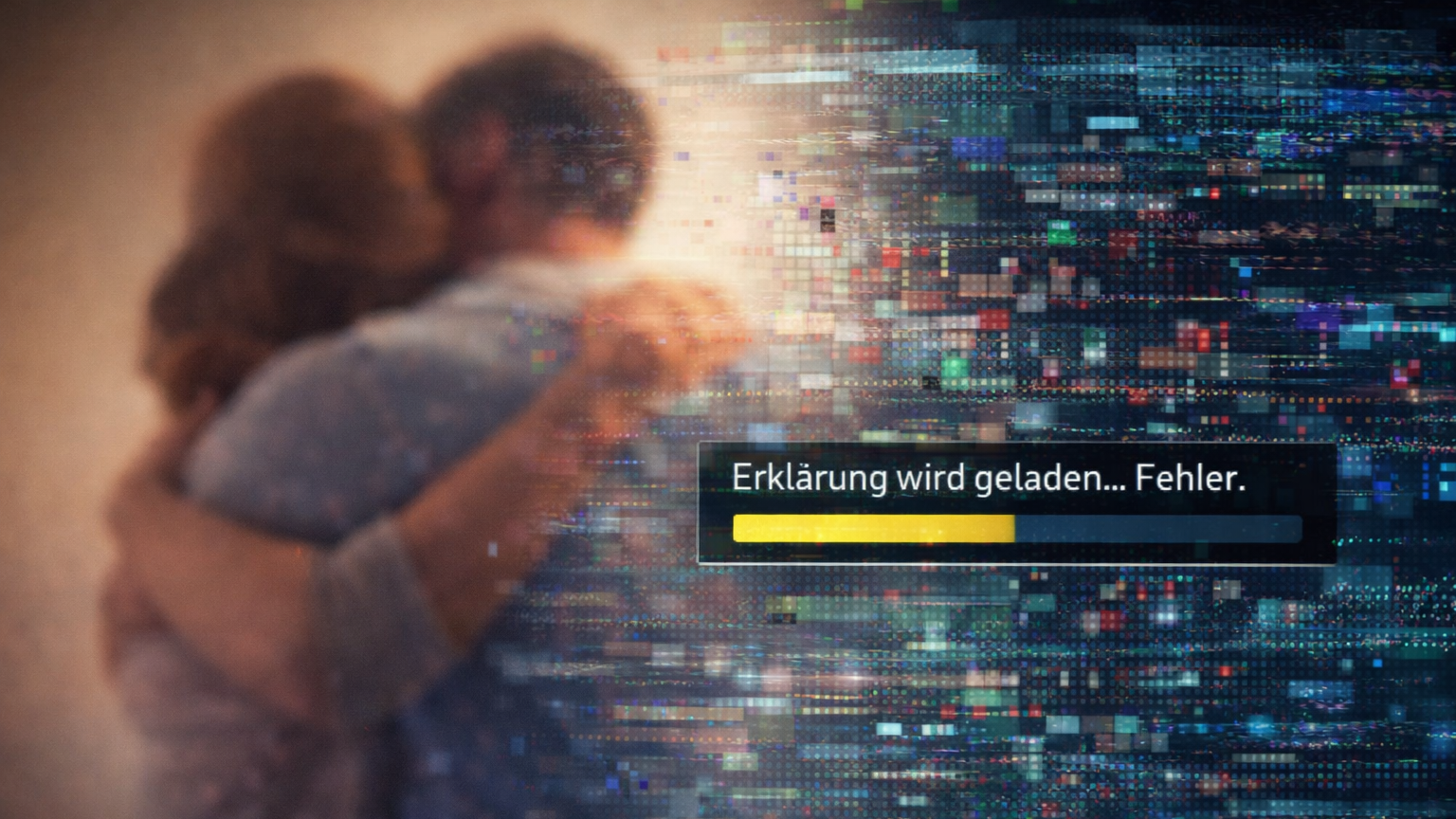



























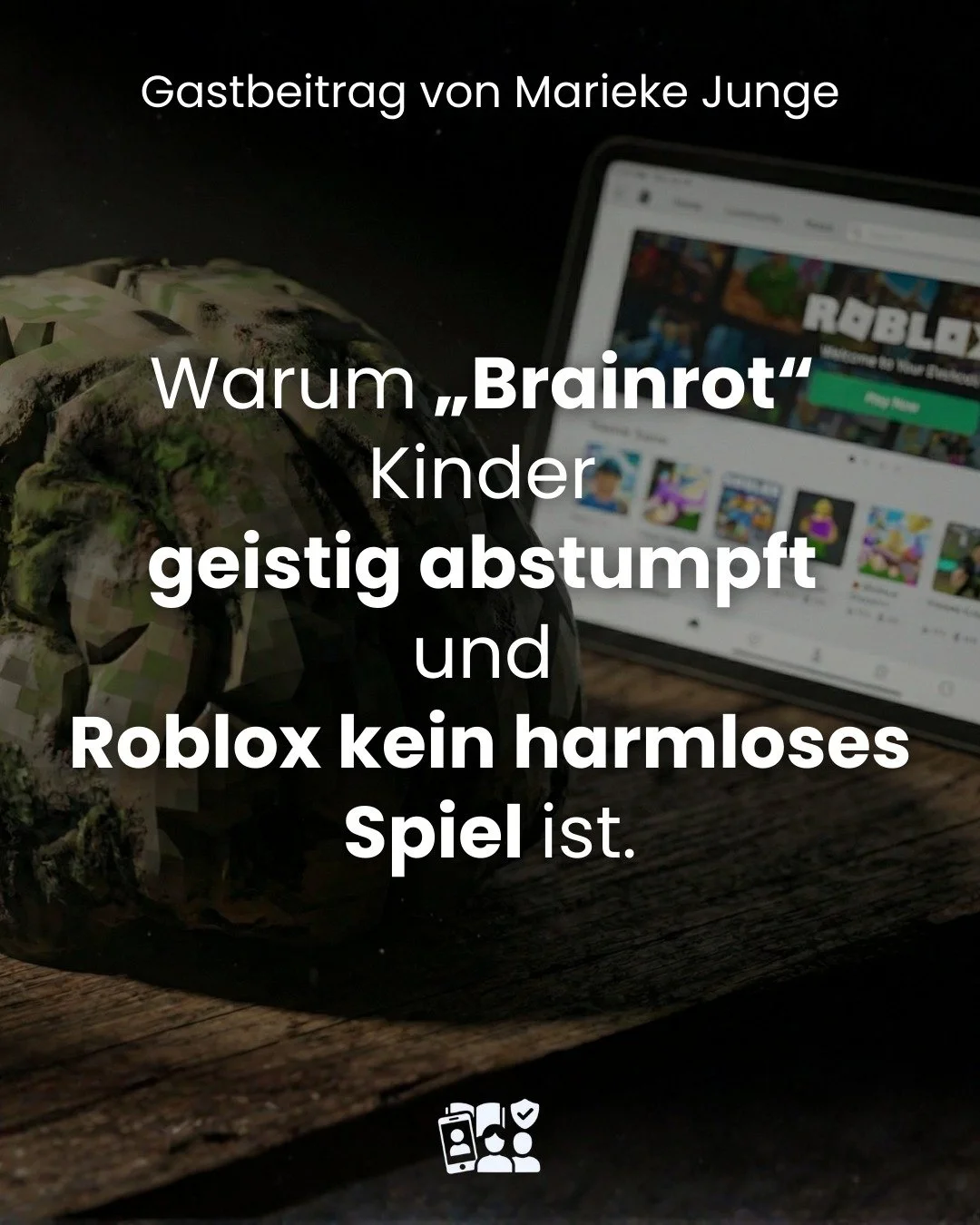



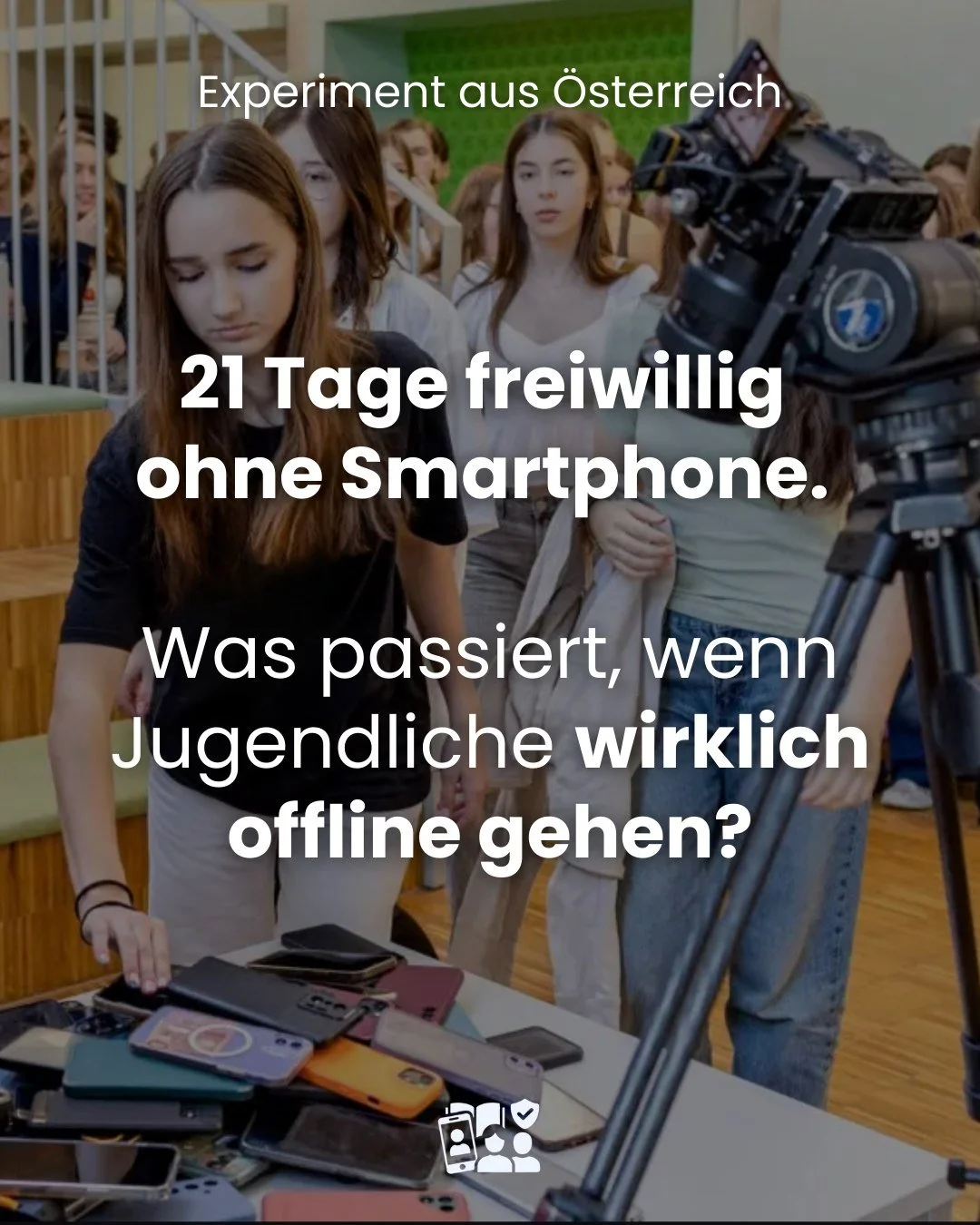


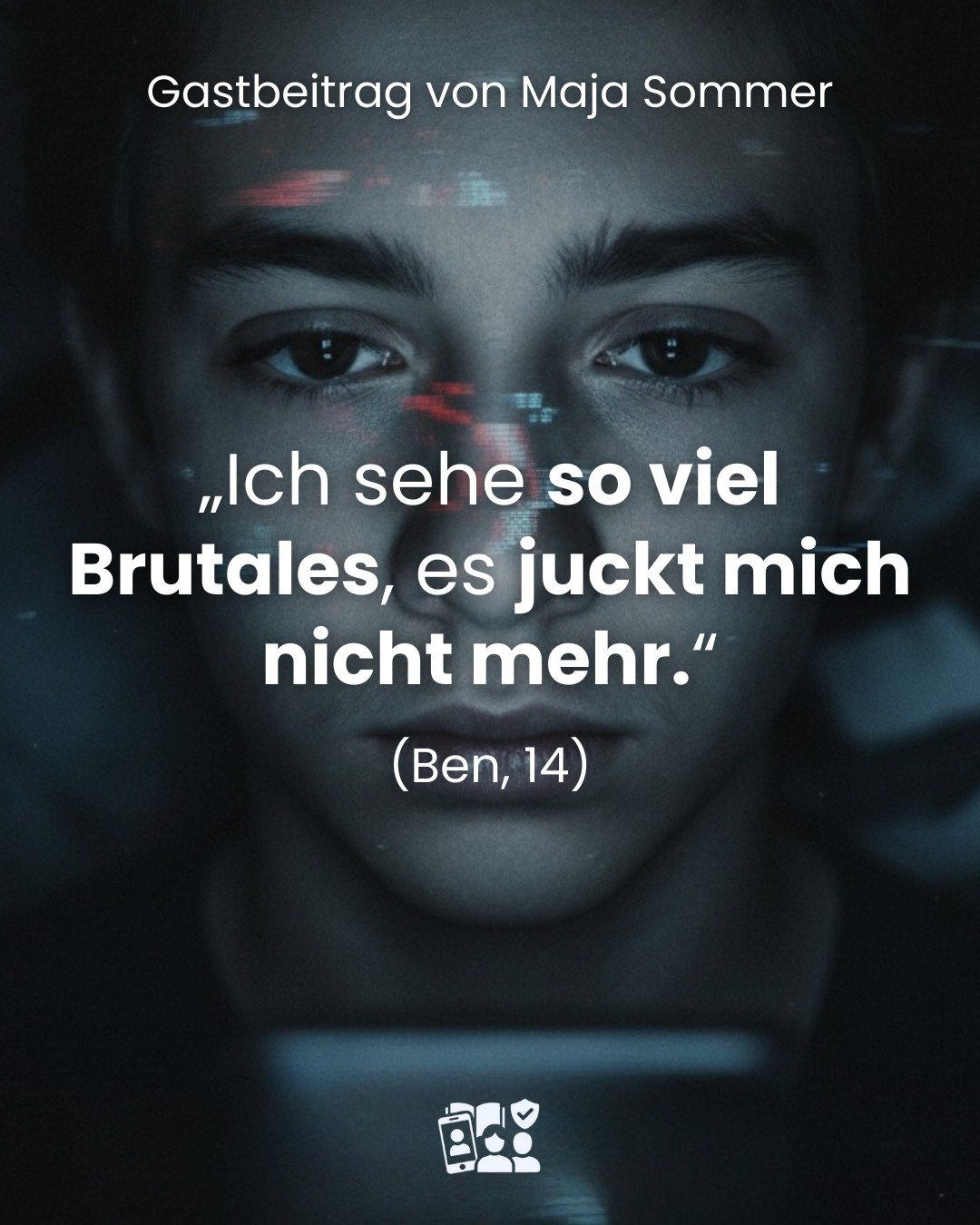
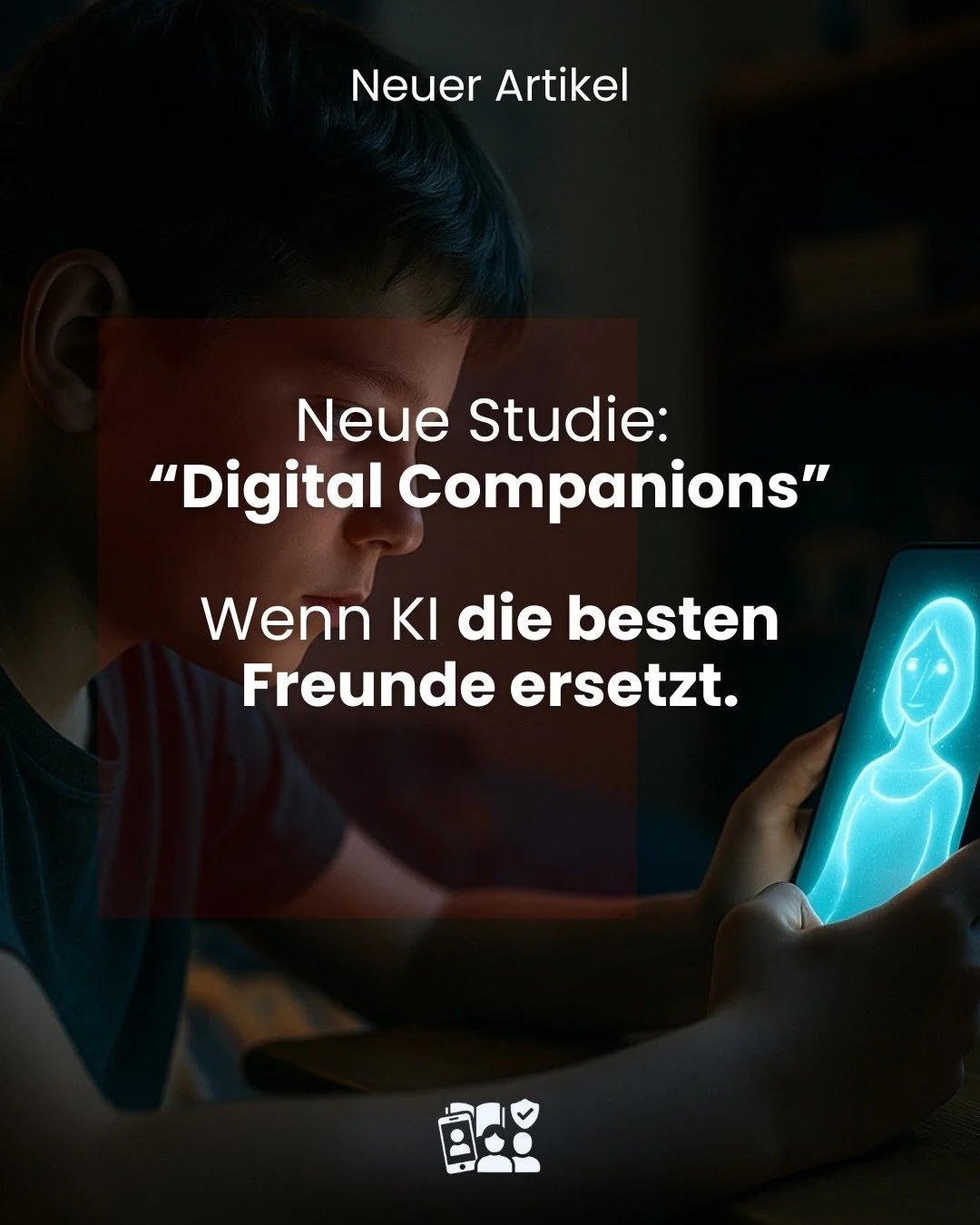

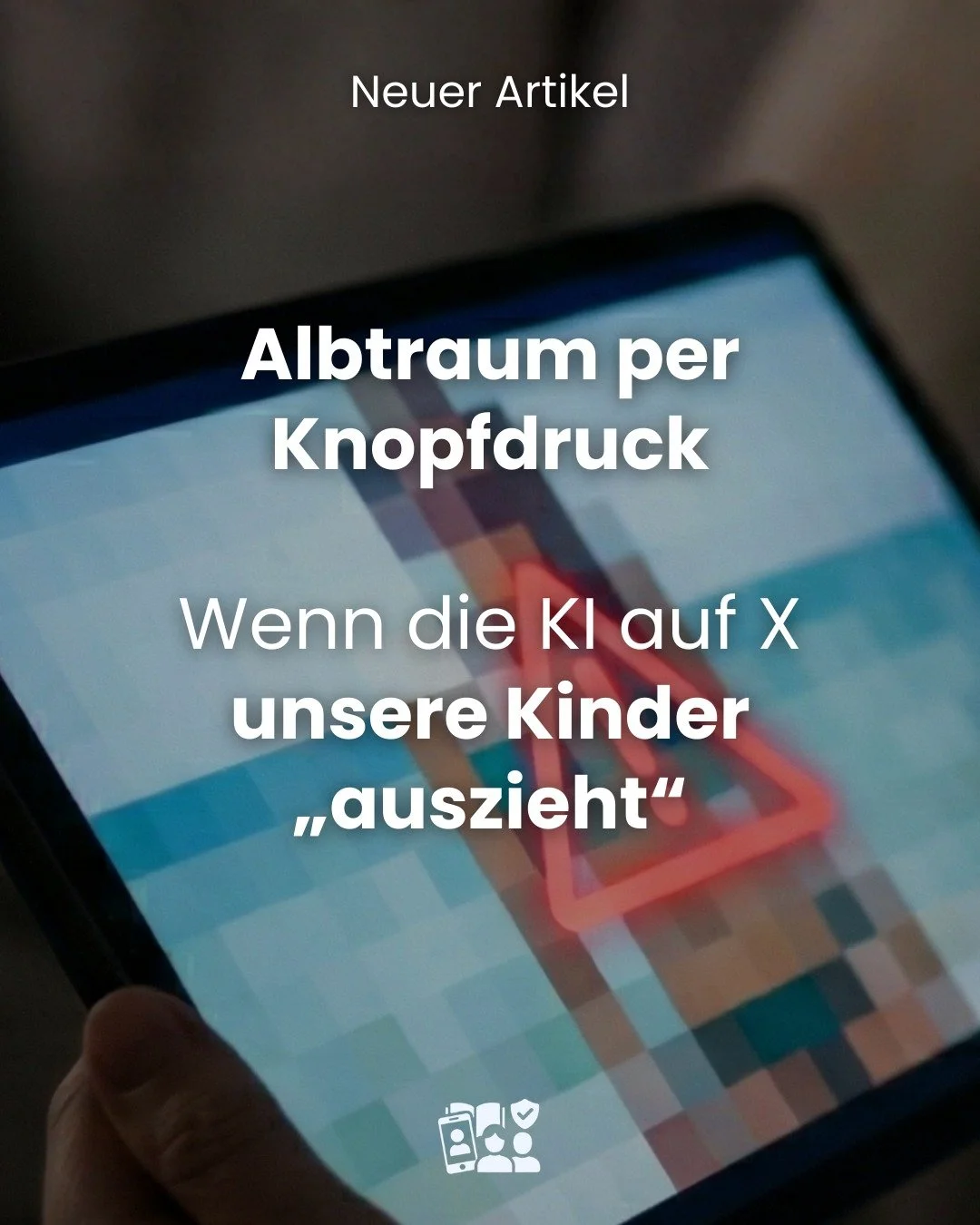

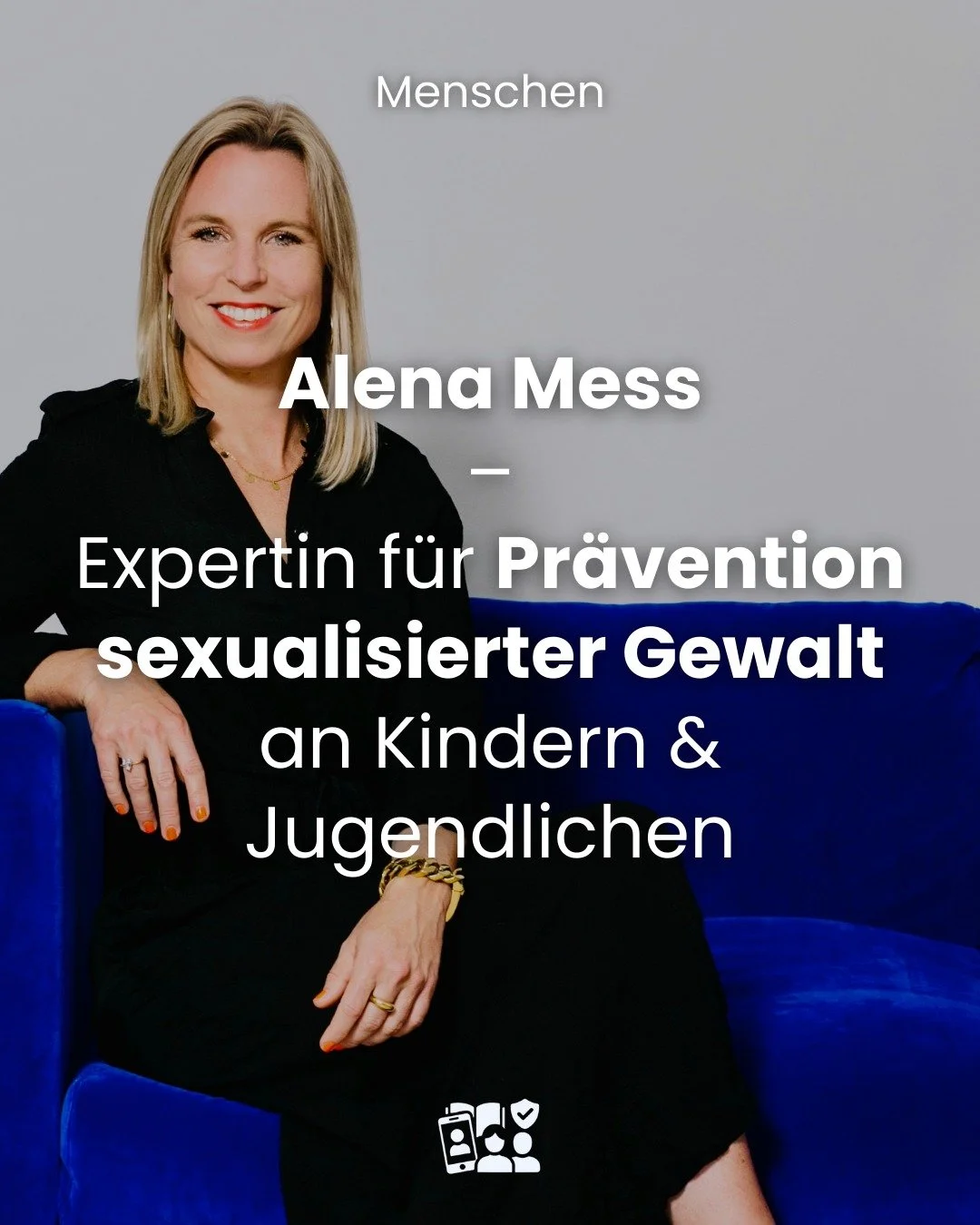
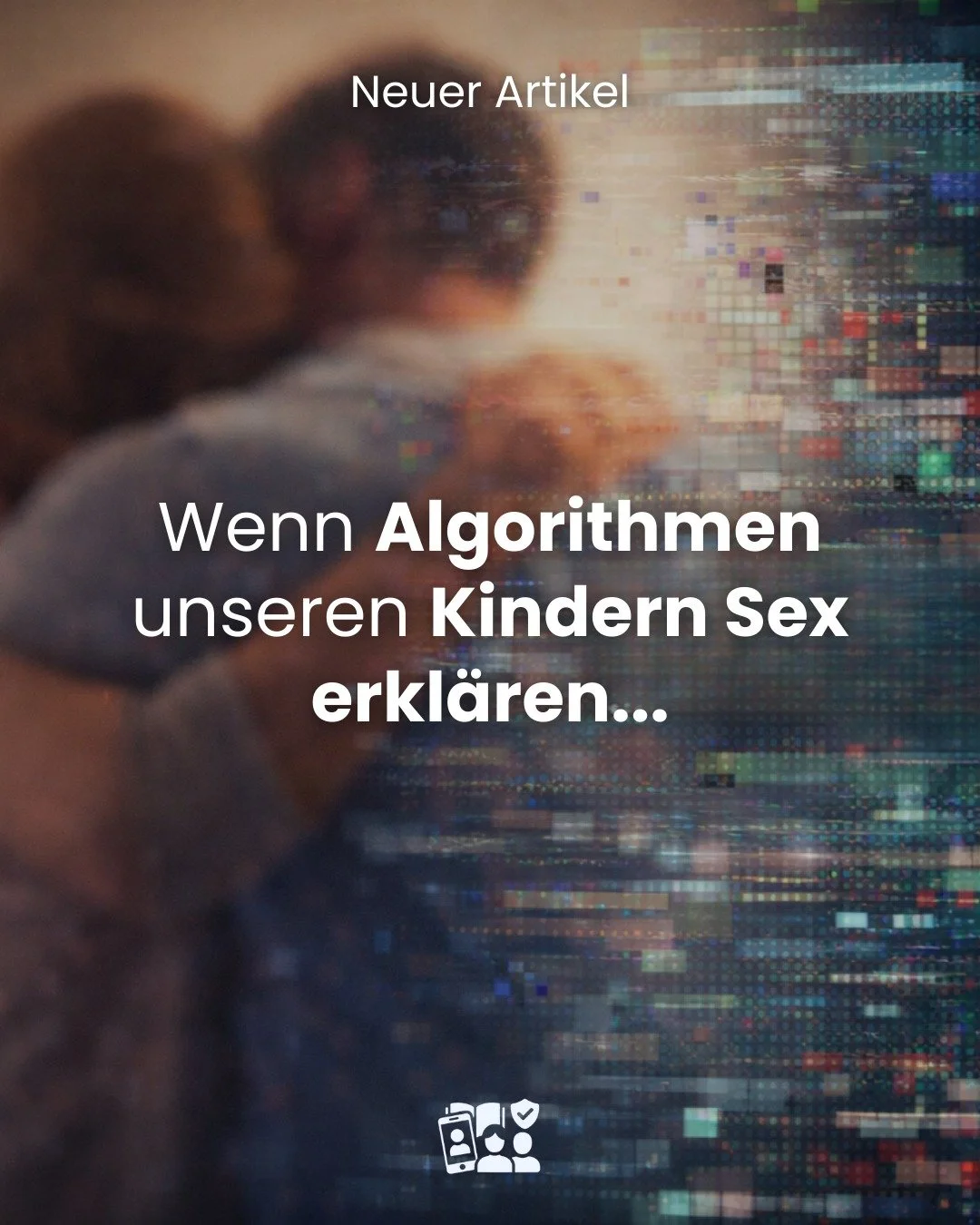




Gastbeitrag von Viola Vens-Cappell
Handyverbot oder smartphonefreie Klasse? Der Unterschied ist größer, als viele denken. Der Beitrag zeigt, warum reine Verbote im Schulalltag oft nicht ausreichen und wie smartphonefreie Klassen Kindern und Eltern spürbar Druck nehmen können.