
Liebe Eltern,
wir alle erleben es jeden Tag: Unsere Kinder wachsen mit Handys, Spielen, Social Media und KI auf – oft schneller, als wir selbst Schritt halten können. Manchmal ist das spannend, manchmal macht es uns Sorgen oder wir haben Fragen.
Medienzeit ist ein Ort, an dem wir diese Themen gemeinsam anschauen. Von Eltern für Eltern – zum Teilen, Nachfragen und Mitreden.
Neueste Artikel
Gastbeitrag von Viola Vens-Cappell
Handyverbot oder smartphonefreie Klasse? Der Unterschied ist größer, als viele denken. Der Beitrag zeigt, warum reine Verbote im Schulalltag oft nicht ausreichen und wie smartphonefreie Klassen Kindern und Eltern spürbar Druck nehmen können.
Was lange als politisch kaum durchsetzbar galt, wird in Großbritannien seit wenigen Tagen offen diskutiert. Ein gesetzliches Verbot von Social Media für unter 16-Jährige ist erstmals nicht mehr ausgeschlossen. Premierminister Keir Starmer erklärte in dieser Woche im Parlament, man sei offen dafür, das australische Modell genau zu prüfen. Ein fertiges Gesetz gibt es nicht. Aber der politische Ton hat sich spürbar verändert.
Was passiert, wenn Jugendliche freiwillig für drei Wochen auf ihr Smartphone verzichten? Nicht für ein paar Stunden. Nicht für einen Projekttag. Sondern für 21 Tage am Stück. Genau dieses Experiment hat Fabian Scheck mit seinen Schülerinnen und Schülern gewagt und damit etwas ausgelöst, das weit über eine einzelne Klasse hinausgeht. Aus einem freiwilligen Selbstversuch wurde eine landesweite Bewegung. Und eine der eindrücklichsten Erfahrungen, die derzeit zeigen, wie tief Smartphones bereits in das Leben junger Menschen eingreifen.
Gastbeitrag von Maja Sommer
Unsere Gesellschaft ist im Umbruch. Als Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin beobachte ich das intensiv und spreche mit Jugendlichen darüber. Ich frage sie, wie es ihnen geht, was sie erleben und was sie brauchen. Wenn eine Antwort kommt wie “es juckt mich nicht mehr”, dann frage ich weiter. Was passiert mit einer Gesellschaft, in der Mitgefühl verloren geht und in der Kinder abstumpfen?
Das Smartphone liegt auf dem Tisch, neben dem Laptop oder am Rand des Schreibtischs und bleibt oft stumm, ohne Nachrichten oder Klingeln. Auf den ersten Blick scheint das kein Problem zu sein. Doch die Forschung zeigt, dass allein die Nähe des eigenen Smartphones unser Denken messbar verschlechtern kann, nicht weil wir es benutzen, sondern weil unser Gehirn weiß, dass es da ist.
Stellt euch vor: Ihr postet ein harmloses Foto eurer Tochter im Sommerkleid oder von euch selbst beim Sport. Und nur Sekunden später kursiert im Netz eine Version dieses Bildes, auf der eure Kleidung digital entfernt oder in sexualisierte Outfits verwandelt wurde. Genau das ist mit Grok, der künstlichen Intelligenz von Elon Musk, zur grausamen Realität geworden. Nutzer konnten Bilder aus dem Netz hochladen und die KI anweisen, Kleidung digital zu entfernen oder zu verändern.
Auf dem Papier wirkt die hessische Regelung streng. „Die private Verwendung ist unzulässig.“ Viele Eltern lehnen sich nach dem Lesen zurück und denken: „Gut, dann ist das Thema endlich geregelt.“ An den Schulen sieht die Realität allerdings anders aus. Die Smartphones liegen in den Taschen, stecken in Jacken oder werden unauffällig in der Hand gehalten. Sie sind immer da, griffbereit in nächster Nähe.
Snapchat wird oft als harmlose Kommunikations-App wahrgenommen. Kurze Nachrichten, lustige Filter, Bilder, die wieder verschwinden. Für viele Eltern wirkt das weniger bedrohlich als offene soziale Netzwerke. Genau das ist das Problem: Snapchat erscheint harmlos, ist es aber strukturell nicht. Die Plattform ist kein neutraler Raum. Ihre Architektur begünstigt systematisch Grenzverletzungen, Manipulation, Erpressung, psychische Überlastung und schwere Straftaten – nicht zufällig, sondern „by Design“.
Online sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist kein Randphänomen. Eine aktuelle Studie aus Kanada zeigt sehr deutlich, wo diese Gewalt besonders häufig stattfindet. In privaten Messaging-Umgebungen und auffallend oft auf Snapchat. Die Ergebnisse stammen nicht aus Polizeistatistiken oder aus Berichten der Plattformen selbst, sondern direkt aus den Erfahrungen betroffener Jugendlicher. Genau das macht diese Studie für Eltern, Schulen und politische Entscheidungen so relevant.
Manche Gespräche entstehen nicht geplant, sondern weil Menschen ähnliche Fragen beschäftigen. So war es auch hier. Jerome Braun hatte mich angerufen, nachdem er immer häufiger über Artikel von Medienzeit gestolpert war. Er wollte verstehen, was wir machen, warum wir das machen, wo das alles herkommt und was aus unserer Sicht noch kommen muss. Aus diesem ersten Austausch ist schließlich eine ganze Podcastfolge entstanden.
Kinder gehören nicht ins Internet! Und schon gar nicht in dem Ausmass, wie wir es heute sehen. Es geht längst nicht mehr nur um Fotos. Heute werden Videos geteilt, Alltagsszenen gezeigt, Geschichten erzählt, Daten veröffentlicht und sogar die Stimmen von Kindern landen online. Oft gut gemeint, oft aus Stolz, manchmal aus Routine. Doch die Folgen tragen später nicht wir, sondern unsere Kinder.
Kinder brauchen Schutzräume. Das klingt selbstverständlich, ist in vielen Schulen aber längst eine tägliche Herausforderung. Der Tagesspiegel berichtet jetzt über die Forderung der Landesärztekammer Brandenburg nach einem grundsätzlichen Handyverbot an Schulen. Wir sind darauf sehr stolz, denn den Impuls für diese Forderung setzen wir mit “Medienzeit” bei einem Vortrag letzten Samstag gemeinsam mit der medizinischen Einordnung von Dr. Steven Rohbeck.
Viele Eltern vertrauen darauf, dass ihr Kind mit der Anton-App lernt. Wir sehen ein Kind mit einem Tablet, wir hören den bekannten Anton-Ton, wir wissen, dass die Schule die App empfiehlt. Alles wirkt sinnvoll und harmlos. Doch in vielen Klassen passiert etwas völlig anderes. Kinder nutzen die Anton-App nicht zum Lernen, sondern zum Spielen. Und das bleibt oft unbemerkt. Der Grund dafür ist ein Trick, der sich seit Monaten in rasantem Tempo verbreitet. Es ist der sogenannte Coin Hack.
Roblox ist absolut kein sicherer Ort für Kinder! Nicht für kleine Kinder, nicht für Grundschulkinder, nicht für Jugendliche. Kein Kind gehört in diese Plattform. Der einzige Grund, warum so viele Kinder trotzdem dort spielen, ist Unwissen. Eltern wissen nicht, was Roblox wirklich ist. Sie wissen nicht, welche Inhalte Kinder dort sehen können, und sie wissen nicht, wie gefährlich die Strukturen dahinter sind.
Gastbeitrag von Viola Vens-Cappell
Handyverbot oder smartphonefreie Klasse? Der Unterschied ist größer, als viele denken. Der Beitrag zeigt, warum reine Verbote im Schulalltag oft nicht ausreichen und wie smartphonefreie Klassen Kindern und Eltern spürbar Druck nehmen können.
Gastbeitrag von Maja Sommer
Unsere Gesellschaft ist im Umbruch. Als Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin beobachte ich das intensiv und spreche mit Jugendlichen darüber. Ich frage sie, wie es ihnen geht, was sie erleben und was sie brauchen. Wenn eine Antwort kommt wie “es juckt mich nicht mehr”, dann frage ich weiter. Was passiert mit einer Gesellschaft, in der Mitgefühl verloren geht und in der Kinder abstumpfen?
Kinder wachsen heute in einer digitalen Welt auf, in der ihr erster Kontakt mit Sexualität immer seltener über Gespräche, Bücher oder Beziehungen entsteht. Stattdessen übernehmen Algorithmen diese Rolle. Algorithmen in sozialen Medien, die nicht auf Schutz, Entwicklung oder Fürsorge ausgelegt sind, sondern auf maximale Aufmerksamkeit und Verweildauer.
Gastbeitrag von Marieke Jung
Schon mal von Skibidi Toilets gehört? Diese Köpfe, die aus Toiletten kommen wie geisteskranke Zombies, deren Anblick einen unwillkürlich am menschlichen Verstand, an Sitte und Moral der Entwickler zweifeln lässt, gehören in vielen deutschen Grundschulen heute neben Fortnite und anderen viralen Phänomenen zum Alltag.
Gastbeitrag von Varvara Herbst, Diplom-Psychologin.
Kinder machen bei Challenges mit, weil sie „mit der Herde schwimmen“ wollen? Weil sie Aufmerksamkeit brauchen? Weil „die Jugend heutzutage halt so ist“? Hinter vielen Challenges stecken ganz normale menschliche Bedürfnisse – nur eben im Turboformat der digitalen Welt: Gesehen werden. Anerkennung. Sich lebendig fühlen. Sich messen. Dazugehören.
Heiligabend ist vorbei. Unter vielen Weihnachtsbäumen lagen Smartphones, Spielkonsolen, Tablets oder neue Games. Für Kinder ist das ein riesiges Geschenk – genau jetzt ist der richtige Moment, dich mit Kinderschutzeinstellungen zu beschäftigen. Nicht später, nicht irgendwann, sondern jetzt. Solange alles noch neu ist und Regeln selbstverständlich wirken.
Gastbeitrag von Julia von Weiler
Digitale Räume gehören längst zu unserem Alltag – und folgen doch eigenen Regeln. Was wir analog intuitiv wahrnehmen, fehlt digital: Tonfall, Blickkontakt, Pausen, all die kleinen Signale, die helfen, Situationen einzuordnen. Stattdessen bestimmen Tempo, Sichtbarkeit und algorithmische Verstärkung die Kommunikation. Das überfordert Kinder – und oft genauso Erwachsene.
Gastbeitrag von Maja Sommer
Kinder und Jugendliche wachsen in einer Welt auf, die komplexer ist, als viele Erwachsene es sich vorstellen. Sie sind täglich online, treffen dort Entscheidungen, sehen Inhalte, folgen Empfehlungen und geraten in Situationen, die sie oft nicht einordnen können. Was ihnen fehlt, ist nicht nur Medienwissen, sondern ein Raum, in dem sie über all das sprechen dürfen.
Gastbeitrag von Varvara Herbst, Diplom-Psychologin.
Wir Menschen wollen etwas schaffen, Kinder ganz besonders. Sie wollen ausprobieren, sich weiterentwickeln, Fähigkeiten aufbauen und erleben ”Ich kann etwas selbst bewirken”. Nicht, weil wir es von ihnen erwarten, sondern weil es ein Grundbedürfnis ist: Selbstwirksamkeit. Doch genau dieses Gefühl geht heute immer häufiger verloren. Nicht, weil Kinder weniger motiviert wären. Sondern weil digitale Plattformen Mechanismen nutzen, die Kinder in den Konsummodus ziehen, statt ins eigene Gestalten.
Kinder gehören nicht ins Internet! Und schon gar nicht in dem Ausmass, wie wir es heute sehen. Es geht längst nicht mehr nur um Fotos. Heute werden Videos geteilt, Alltagsszenen gezeigt, Geschichten erzählt, Daten veröffentlicht und sogar die Stimmen von Kindern landen online. Oft gut gemeint, oft aus Stolz, manchmal aus Routine. Doch die Folgen tragen später nicht wir, sondern unsere Kinder.
Viele Eltern vertrauen darauf, dass ihr Kind mit der Anton-App lernt. Wir sehen ein Kind mit einem Tablet, wir hören den bekannten Anton-Ton, wir wissen, dass die Schule die App empfiehlt. Alles wirkt sinnvoll und harmlos. Doch in vielen Klassen passiert etwas völlig anderes. Kinder nutzen die Anton-App nicht zum Lernen, sondern zum Spielen. Und das bleibt oft unbemerkt. Der Grund dafür ist ein Trick, der sich seit Monaten in rasantem Tempo verbreitet. Es ist der sogenannte Coin Hack.
Gastbeitrag von Varvara Herbst, Diplom-Psychologin.
Kinder wollen erleben. Nicht nebenbei, nicht passiv, sondern richtig, mit allen Sinnen. Sie wollen lachen, gestalten, Neues ausprobieren und eintauchen. Kurz gesagt: Sie wollen Spiel & Spaß. Wenn sie also ans Gerät wollen, geht es oft einfach nur um einen schnellen Zugang zu Freude, Spannung und Flow. Und genau hier geraten Eltern unter Druck: Wir wollen unser Kind nicht dauernd „bespaßen“, aber wir wollen auch nicht, dass Langeweile automatisch in Bildschirmzeit endet.
Gastbeitrag von Varvara Herbst, Diplom-Psychologin. Wenn Kinder nach einem Smartphone fragen, geht es selten um das Gerät selbst, sondern um das Gefühl, verbunden zu sein: Mit Freunden, mit der Klasse, mit dem, was „alle“ gerade tun. Denn Kinder wollen einfach dazugehören. Sie wollen Teil der Gruppe sein, nicht außen vor. Wir Eltern stehen dabei oft im Spannungsfeld zwischen sozialem Druck, dem Wunsch nach Schutz und einer digitalen Welt, die sich schneller entwickelt, als wir mitkommen.
Viele Eltern und Kinder wissen eigentlich, dass es nichts umsonst gibt. Auch Apps und Spiele nicht. Hinter jeder App stehen Menschen, die Gehälter brauchen. Entwickler haben Familien, zahlen Miete und haben ganz normale Rechnungen. Irgendwoher muss also das Geld kommen.vIn der Regel kommt das Geld über Werbung, Käufe in der App oder aus dem Verkauf von Daten, die beim Nutzen der App entstehen. Genau hier beginnt das Problem.
Fotos vom ersten Schultag, das neue Fahrrad, ein Video vom Kindergeburtstag. Wir alle haben solche Momente schon geteilt. Oft aus Stolz, manchmal um Familie und Freunde teilhaben zu lassen. Doch was harmlos beginnt, hat einen Namen: Sharenting. Und es kann Folgen haben, die wir beim Posten kaum ahnen.
Ein Gastbeitrag von Marieke Junge
Als Mutter, Philosophin und Pädagogin schaue ich mit besonderer Aufmerksamkeit und zunehmender Sorge auf digitale Spielewelten, die sich an Kinder und Jugendliche richten. Ich bin nicht grundsätzlich gegen digitale Spiele. Aber ich bin, wie wohl viele Leserinnen und Leser hier, medienkritisch. Und ich halte es für unsere Verantwortung als Erwachsene, genauer hinzusehen, wenn Unterhaltungsindustrien beginnen, Denken, Aufmerksamkeit und Entwicklung von Kindern systematisch zu kontrollieren.
PingTok ist kein neues soziales Netzwerk und auch keine eigene App. Der Begriff beschreibt einen Trend auf TikTok, bei dem Drogenkonsum gezeigt, angedeutet oder ästhetisch inszeniert wird. Meist taucht das Ganze unter Hashtags wie #pingtok auf. Gemeint ist vor allem der Konsum von MDMA oder Ecstasy, teilweise auch Kokain, Speed oder andere Substanzen. Die Inhalte sind kurz, visuell stark und emotional aufgeladen. Genau das macht sie für Kinder und Jugendliche besonders wirksam.
Snapchat wird oft als harmlose Kommunikations-App wahrgenommen. Kurze Nachrichten, lustige Filter, Bilder, die wieder verschwinden. Für viele Eltern wirkt das weniger bedrohlich als offene soziale Netzwerke. Genau das ist das Problem: Snapchat erscheint harmlos, ist es aber strukturell nicht. Die Plattform ist kein neutraler Raum. Ihre Architektur begünstigt systematisch Grenzverletzungen, Manipulation, Erpressung, psychische Überlastung und schwere Straftaten – nicht zufällig, sondern „by Design“.
„Mama, ich kenn ihn von Insta – der ist echt nett. Wir schreiben schon voll lange.“
Was viele Eltern als harmlose Schwärmerei abtun, ist manchmal der Anfang eines Albtraums. Denn in der heutigen digitalen Welt braucht es keinen dunklen Park, keine zwielichtige Bar, kein Hinterzimmer mehr. Wer junge Mädchen emotional manipulieren will, braucht nur eines: Zugang zu ihrem Smartphone.
Und dieser Zugang ist einfach, oft sogar erschreckend einfach.
Viele Eltern glauben, sie hätten TikTok auf dem Handy ihres Kindes gesperrt und damit das Problem gelöst. Leider stimmt das nicht. TikTok ist fast überall erreichbar, auch ohne App und ohne Account. Das macht es für Familien besonders schwer, die Plattform wirklich aus dem Alltag herauszuhalten.
Stellt euch vor: Ihr postet ein harmloses Foto eurer Tochter im Sommerkleid oder von euch selbst beim Sport. Und nur Sekunden später kursiert im Netz eine Version dieses Bildes, auf der eure Kleidung digital entfernt oder in sexualisierte Outfits verwandelt wurde. Genau das ist mit Grok, der künstlichen Intelligenz von Elon Musk, zur grausamen Realität geworden. Nutzer konnten Bilder aus dem Netz hochladen und die KI anweisen, Kleidung digital zu entfernen oder zu verändern.
Als Eltern teilen wir Fotos unserer Kinder meist aus Liebe. Wir wollen Erinnerungen bewahren, Nähe zeigen und besondere Momente festhalten. Lange fühlte sich das selbstverständlich und harmlos an. Doch diese Sicherheit gibt es nicht mehr. Im Zeitalter Künstlicher Intelligenz hat sich die Bedeutung eines Fotos grundlegend verändert. Ein Bild ist heute kein eingefrorener Moment mehr, sondern ein Datensatz mit einer ungewissen Zukunft.
TikTok verändert sich gerade grundlegend. Nicht durch neue Trends oder prominente Creator, sondern durch eine wachsende Industrie aus KI-gesteuerten Accounts. Und die werden jeden Tag besser darin, unbemerkt zu bleiben. Eine neue Studie von AI Forensics zeigt, wie groß dieses Problem geworden ist und warum Kinder und Jugendliche davon besonders betroffen sind.
Kinder wachsen heute mit KI auf, ob wir das wollen oder nicht. Sie begegnen ihr in den Apps, die sie nutzen, in Filtern, die ihre Gesichter verändern, in Suchergebnissen, die ihre Welt sortieren, und immer häufiger auch in Lernprogrammen oder Chats. KI ist längst kein Zukunftsthema mehr. Sie ist Teil des Alltags unserer Kinder. Teil ihrer sozialen Realität. Und genau deshalb müssen wir darüber sprechen, was viele Eltern noch nicht wissen. KI ist nicht neutral. KI ist nicht objektiv. KI ist sexistisch. Nicht, weil das jemand absichtlich programmiert hätte, sondern weil KI aus Daten lernt, die voller Ungleichheiten sind. Daten, die Frauen seit Jahrzehnten benachteiligen.
Immer mehr Kinder und Jugendliche reden heute nicht nur mit echten Freunden, sondern auch mit digitalen Begleitern. Die Chai App ist dabei eine der beliebtesten Plattformen. Vor allem bei elf bis sechzehnjährigen ist sie unglaublich weit verbreitet. Viele Eltern kennen sie nicht einmal, obwohl ihre Kinder dort jeden Tag Zeit verbringen. Für viele Jugendliche gehört Chai bereits zum Alltag. Sie wechseln zwischen WhatsApp, TikTok und Chatfenstern mit einer Figur, die wie ein echter Freund wirkt.
Tipp: Game Nest ist keine einzelne Spielidee sondern eine Sammlung klassischer Spiele in einer einzigen App. Über 30 bekannte Spiele sind hier gebündelt. Darunter Logikspiele, Denkspiele und einfache Reaktionsspiele. Alles ist bewusst reduziert gestaltet. Keine grellen Effekte kein Dauerlärm keine Ablenkung. Die App funktioniert vollständig offline. Es gibt keine Chats, keine Ranglisten und keinen Kontakt zu anderen Nutzerinnen oder Nutzern.
Der Generalstaatsanwalt des US-Bundesstaates Florida, James Uthmeier, hat strafrechtliche Vorladungen gegen die Spieleplattform Roblox erlassen. Hintergrund sind schwere Vorwürfe. Roblox soll Strukturen geschaffen haben, die sexualisierte Übergriffe auf Kinder erleichtern. Die Ermittlungen prüfen, ob interne Regeln, Schutzmechanismen und Meldewege ausreichen oder ob sie Tätern systematisch den Zugang zu Minderjährigen ermöglichen.
Wenn Kinder uns voller Stolz erzählen: „Ich hab jetzt meinen eigenen Server“, klingt das harmlos, fast niedlich. Ein bisschen Technik, ein bisschen Spielen, nichts Wildes. Viele Eltern lächeln dann und denken, gut, immerhin ist es privat. Doch was hinter diesem Satz steckt, verstehen viele erst dann, wenn etwas schiefgeht. Genau darüber müssen wir sprechen.
Ein Land zieht Konsequenzen. Russland hat Roblox komplett blockiert. Begründung: extremistische Inhalte, Gewalt, sexuelle Anspielungen, Glücksspielmechaniken und massive Gefährdungen für Minderjährige. Roblox ist weltweit eine der beliebtesten Plattformen für Kinder und eine der gefährlichsten. Wir haben euch gezeigt, welche Inhalte Kinder dort finden können, wie leicht Erwachsene Kontakt aufnehmen und wie offen, unkontrolliert und ungeschützt diese Spielwelt in Wahrheit ist.
Roblox ist absolut kein sicherer Ort für Kinder! Nicht für kleine Kinder, nicht für Grundschulkinder, nicht für Jugendliche. Kein Kind gehört in diese Plattform. Der einzige Grund, warum so viele Kinder trotzdem dort spielen, ist Unwissen. Eltern wissen nicht, was Roblox wirklich ist. Sie wissen nicht, welche Inhalte Kinder dort sehen können, und sie wissen nicht, wie gefährlich die Strukturen dahinter sind.
Viele Kinder, schon ab der Grundschule, spielen Clash Royale. Was harmlos aussieht, ist in Wahrheit ein Spiel, das Kinder gezielt an sich bindet. Und viele Eltern wissen gar nicht, wie tief Kinder da hineinrutschen können – ohne dass wir es merken.
Stumble Guys ist die Mobile-Version von „Fall Guys“, einem chaotischen Online-Wettbewerbsspiel. Bis zu 32 Spieler treten in bunten Minispielen gegeneinander an: Wer kommt am schnellsten durchs Ziel, wer bleibt am längsten stehen? Für Kinder wirkt es lustig, albern und harmlos – wie ein „Spielplatz“ am Handy.
Subway Surfers wirkt auf den ersten Blick harmlos: ein farbenfrohes Endlos-Runner-Spiel, bei dem Kinder über Gleise laufen, Zügen ausweichen und Münzen sammeln. Alles ist bunt, schnell und leicht verständlich – kein Blut, keine sichtbare Gewalt. Genau diese Unschuld macht es so attraktiv, besonders für Grundschüler. Das Gefühl, immer schneller und geschickter zu werden, sorgt für eine ständige Motivation.
PUBG Mobile zieht Kinder und Jugendliche stark an, weil es Spannung, Wettbewerb und Teamgefühl kombiniert. Jede Runde bietet Nervenkitzel: aus dem Flugzeug springen, Beute sammeln, andere besiegen – bis man selbst der letzte Überlebende ist. Das schnelle Fortschrittssystem, Ranglisten und Belohnungen sorgen dafür, dass man „dranbleiben“ will. Genau hier liegt die Gefahr.
Clash of Clans ist für Kinder auf den ersten Blick ein spannendes Strategiespiel, tatsächlich aber ein durchdachtes Geschäftsmodell, das auf Geduld, Gruppenzwang und Kaufanreizen basiert. Es vermittelt problematische Werte: Zerstörung wird belohnt, Geduld wird bestraft, und Geld scheint der Schlüssel zum Erfolg zu sein.
Fast jedes Kind spielt heute Mobile Games. Ob im Bus, auf dem Sofa oder im Bett – die bunten Apps passen in jede Hosentasche und sind rund um die Uhr verfügbar. Für uns Eltern wirkt es zunächst harmlos: „Es ist doch nur ein Spiel.“ Doch wer genauer hinschaut, merkt schnell: Viele dieser Spiele sind so gebaut, dass Kinder stundenlang dabeibleiben – und dabei unter Druck geraten.
Minecraft gilt als „digitales Lego“ und hat einen Ruf als Kreativspiel. Kinder können Häuser, Städte und ganze Welten aus Blöcken bauen. Für viele Eltern klingt das zunächst positiv und sogar pädagogisch wertvoll.
Doch die Realität ist eine andere: Über 90 % der Kinder spielen nicht kreativ, sondern im Überlebensmodus. Dort geht es vor allem darum, Zombies und Monster zu besiegen.
Plattformen wie Roblox, Fortnite oder FIFA haben das Spielverhalten von Kindern radikal verändert. Hinter den bunten Avataren und scheinbar harmlosen Welten steckt oft ein System, das gezielt auf Bindung, Geldfluss und Kontrolle ausgelegt ist – nicht auf Sicherheit. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf acht konkrete Gefahren, die sich aus der Struktur moderner Games ergeben – und zeigen, wie du dein Kind schützen kannst.
Kinder laufen durch tausende Attraktionen, bezahlen mit virtueller Währung für Rätselboxen und Drehräder, tragen Masken, Avatare, niemand ist zu erkennen. Altersbeschränkungen? Ohne Kontrolle.
Inhalte? Von Krimispielen mit Leichenteilen über Nazi-Rollenspiele bis zu sexualisierter Gewalt – alles ist da.
Und mittendrin ist euer Kind.
In „Brawl Stars“ treten Spieler in kleinen Arenen gegeneinander an. Sie wählen eine Figur und kämpfen in Teams oder allein, je nach Spielmodus. Jede Figur hat spezielle Angriffe und eine „Superfähigkeit“. Man sammelt Trophäen, steigt in Ligen auf und erhält Belohnungen.
Smartphones gehören längst zum Alltag von Kindern und Jugendlichen. Im Schulalltag sorgen sie jedoch oft für das Gegenteil von dem, was Lernen braucht: Ruhe, Fokus und echte Begegnung. Ablenkung, Konflikte, heimliche Nutzung und ständige Unterbrechungen prägen vielerorts den Unterricht. Genau hier setzt Lock&Learn an.
Kinder bewegen sich heute selbstverständlich im Netz, oft früher, als wir denken. Doch Sicherheit im Digitalen beginnt nicht mit Technik, sondern mit Verständnis. Warum digitale Aufklärung in der Grundschule genauso wichtig ist wie die Fahrradprüfung und wie Kinder lernen können, sich selbst zu schützen.
Auf dem Papier wirkt die hessische Regelung streng. „Die private Verwendung ist unzulässig.“ Viele Eltern lehnen sich nach dem Lesen zurück und denken: „Gut, dann ist das Thema endlich geregelt.“ An den Schulen sieht die Realität allerdings anders aus. Die Smartphones liegen in den Taschen, stecken in Jacken oder werden unauffällig in der Hand gehalten. Sie sind immer da, griffbereit in nächster Nähe.
AirDrop ist super praktisch, war aber lange ein Einfallstor für digitale Belästigung bei Kindern wie z. B.„Cyber-Flashing“. Damit ist jetzt Schluss! Apple hat Ende 2025 mit einem wichtigen Sicherheits-Update reagiert. Erfahre hier, wie der neue 6-stellige Schutz-Code für Fremde funktioniert und welche drei Einstellungen du am Handy deines Kindes jetzt unbedingt prüfen solltest.
Sextortion bedeutet, dass Menschen mit intimen Bildern erpresst werden. Die Täter drohen, diese Bilder zu verbreiten, wenn kein Geld gezahlt wird. Viele Eltern hören diesen Begriff zum ersten Mal. Doch das Thema betrifft längst auch Kinder und Jugendliche. Eine neue Schadsoftware mit dem Namen Stealerium zeigt, wie schnell Situationen entstehen können, die für junge Menschen peinlich sind und von Kriminellen ausgenutzt werden.
Mehr als die Hälfte aller Jugendlichen erlebt in ihrer ersten Beziehung Gewalt. Das zeigen aktuelle Studien aus Deutschland und der Schweiz. Die häufigste Form ist nicht körperlich, sondern digital: sogenanntes “Monitoring”, also das ständige Überwachen, Mitlesen oder Einschränken der Kontakte des Partners oder der Partnerin. Was dabei oft harmlos klingt („Ich will nur wissen, mit wem du schreibst“) wird schnell zu Kontrolle. Viele Jugendliche halten das für normal oder sogar für ein Zeichen von Liebe. Doch genau hier beginnt digitale Gewalt.
Viele Eltern sperren Apps auf dem Handy oder Tablet, damit ihre Kinder geschützt sind. Doch was viele nicht wissen: dieselben Inhalte sind oft ganz ohne App über den Browser erreichbar. Und dort greift keine Kontrolle. Kinder öffnen einfach den Browser, tippen die Adresse ein und umgehen so jede Sperre.
Wenn Meta neue „Kinderschutzfunktionen“ ankündigt, lohnt es sich, genau hinzusehen. Zu oft haben wir in den vergangenen Jahren erlebt, dass große Worte gemacht wurden und am Ende kaum etwas davon blieb. Jetzt also der nächste Versuch: Eltern sollen bald sehen können, mit welchen KI-Charakteren ihre Kinder auf Instagram, WhatsApp oder Facebook chatten, worüber sie sprechen und ob sie diese Funktionen sperren wollen.
Ab Dezember 2025 will OpenAI in ChatGPT erotische Inhalte für Erwachsene zulassen – ein Schritt, der laut Unternehmen nur nach Altersverifikation möglich sein soll. Wie diese Prüfung konkret abläuft, ist bisher unklar. Fest steht: ChatGPT soll künftig auch erotische Texte und Rollenspiele ermöglichen – ein Thema, das viele Eltern alarmiert.
Viele Eltern verlassen sich darauf, dass sie die Smartphone-Nutzung ihrer Kinder gut im Blick haben. Doch immer mehr Jugendliche finden Wege, diese Schutzmechanismen komplett auszuhebeln – mit einem Zweithandy, oft ein älteres Gerät oder ein günstiges Gebrauchtmodell. Was harmlos klingt, ist in Wahrheit ein kompletter Kontrollverlust.
Kinder wachsen in einer Welt auf, die digital und grenzenlos scheint – aber eben nicht sicher. Wer glaubt, die Jugendschutz-Einstellungen der Plattformen würden ausreichen, täuscht sich. Viele Anbieter ignorieren gesetzliche Vorgaben oder setzen sie nur halbherzig um – auf Kosten unserer Kinder.
Griechenland hat als erstes Land in der EU ein klares Verbot ausgesprochen: Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen ab Ende Oktober keine Social-Media-Plattformen wie TikTok, Instagram oder Snapchat mehr nutzen.
Auf Instagram tauchen seit einigen Jahren immer wieder sogenannte „Beichtstühle“ auf – anonyme Accounts, die Kindern und Jugendlichen versprechen: „Schick uns deine Beichte, wir posten sie für dich.“ Was zunächst nach harmlosen Schulwitzen klingt, entwickelt sich schnell zu einem Ort für Mobbing, Gerüchte und öffentliche Bloßstellungen – oft mit gravierenden Folgen für Betroffene.
Mobbing gab es schon immer: Hänseleien auf dem Pausenhof, Ausgrenzungen in der Klasse, verletzende Worte. Doch mit dem Smartphone hat Mobbing eine völlig neue Dimension erreicht: Cybermobbing. Es findet nicht mehr nur in der Schule statt, sondern rund um die Uhr – und es kann Hunderte oder sogar Tausende von Menschen erreichen. Für Kinder ist das eine Belastung, die weit über klassische Konflikte hinausgeht.
Das Internet öffnet Kindern Türen zu Spielen, Chats und sozialen Netzwerken. Leider öffnet es auch Türen für Erwachsene, die dort nichts verloren haben: Fremde, die gezielt den Kontakt zu Kindern suchen. Dieses Vorgehen nennt man Cybergrooming – und es ist eine der größten Gefahren, die mit Smartphones ins Kinderzimmer einziehen.
So stellst du Apps & Geräte ein.
YouTube hat im Januar 2026 neue Funktionen angekündigt, mit denen Eltern die Nutzung der Plattform durch Kinder und Jugendliche gezielter steuern können. Im Mittelpunkt stehen dabei der besonders suchterzeugende Kurzvideo-Bereich Shorts, eine vereinfachte Verwaltung von Familienprofilen sowie neue Qualitätskriterien für Inhalte, die Jugendlichen empfohlen werden.
Kinder entdecken ständig neue Wege, ihre digitalen Freiräume auszubauen, dazu gehört auch das Verstecken von Apps auf dem Smartphone oder Tablet. Es kann dabei ganz harmlose Gründe geben (z. B. ein Spiel „heimlich“ ausprobieren), aber auch solche, die Eltern Sorgen machen: etwa ungeprüfte soziale Netzwerke, Chat-Apps oder andere Inhalte, die nicht altersgerecht sind. In diesem Artikel gehen wir darauf ein, wie Kinder Apps verstecken und vor allem, wie Eltern trotzdem solche Apps finden können.
Instagram ist für viele Kinder und Jugendliche der erste Einstieg in soziale Netzwerke. Fotos posten, Stories teilen, Freunden folgen – das klingt harmlos, bringt aber auch Risiken mit sich: Fremde Nachrichten, ungeeignete Inhalte, Gruppendruck. Die gute Nachricht: Instagram bietet inzwischen verschiedene Funktionen, die Eltern nutzen können, um die Nutzung sicherer zu machen.
TikTok ist eine der beliebtesten Apps bei Kindern und Jugendlichen. Die kurzen Videos sind witzig, kreativ – und ziehen Kinder oft stundenlang in den Bann. Gleichzeitig gibt es Risiken: unangemessene Inhalte, Fremde in den Kommentaren oder zu viel Bildschirmzeit.
Wenn dein Kind sagt: „Alle aus meiner Klasse sind schon in WhatsApp!“, fühlst du dich wahrscheinlich hin- und hergerissen. Einerseits ist es praktisch, schnell zu schreiben. Andererseits spürst du: Da steckt mehr drin als harmlose Chats.
Das Smartphone liegt auf dem Tisch, neben dem Laptop oder am Rand des Schreibtischs und bleibt oft stumm, ohne Nachrichten oder Klingeln. Auf den ersten Blick scheint das kein Problem zu sein. Doch die Forschung zeigt, dass allein die Nähe des eigenen Smartphones unser Denken messbar verschlechtern kann, nicht weil wir es benutzen, sondern weil unser Gehirn weiß, dass es da ist.
Vielleicht kennst du das: Aus „nur noch fünf Minuten“ am Smartphone wird schnell eine weitere Stunde. Als Eltern schwanken wir zwischen Frust und Sorge. Eine Jugendstudie der Vodafone Stiftung zeigt: Oft fehlt nicht Disziplin, sondern Kinder kämpfen gegen Plattformen, die ihre Selbststeuerung gezielt aushebeln.
Viele Eltern haben ein ähnliches Gefühl: Das Handy ist immer dabei, irgendeine App läuft immer, und man weiß oft nur grob, was Kinder dort eigentlich machen. Die JIM Studie 2025 gibt dazu klare Zahlen. Seit 1998 untersucht sie jedes Jahr, wie Jugendliche von 12 bis 19 Jahren in Deutschland mit Medien umgehen. Sie ist so etwas wie der Standard, wenn es um Fakten zur Mediennutzung von Jugendlichen geht.
Wenn es um Social-Media-Sucht geht, denken die meisten an Jugendliche. Doch eine aktuelle Untersuchung der Hochschule Macromedia zeigt: Das Problem betrifft längst auch Erwachsene – und zwar in erheblichem Maß.
Zwei Mütter wollten wissen, was Kinder wirklich auf Instagram sehen. Sie legten Test-Accounts an – als 13-jährige Mädchen, ohne Freunde, ohne Verlauf, ohne Likes. Nur der Algorithmus hatte Zugriff.
Das Ergebnis nach nur drei Stunden:
⚠️ Rassistische Inhalte
⚠️ Sexualisierte Inhalte
⚠️ Werbung für Drogen und Alkohol
„Brain Rot“ durch Smartphones ist längst kein Witz mehr. Was als Meme in den sozialen Medien begann – ein sarkastischer Kommentar zur digitalen Dauerberieselung – wird nun von der Wissenschaft bestätigt: Unser Gehirn verändert sich. Und nicht zum Guten. Neue Studien zeigen, dass schon zwei Stunden zielloses Scrollen pro Tag zu messbaren Veränderungen im Gehirn führen können.
Eltern sagen oft: „Mein Kind muss früh mit dem Smartphone umgehen, um Medienkompetenz aufzubauen.“ Klingt logisch – ist aber ein Trugschluss. Medienkompetenz entsteht nicht durch frühe oder häufige Nutzung digitaler Geräte. Das zeigen auch die Zahlen: Laut KIM-Studie 2023 nutzen bereits 76 % der 10- bis 12-Jährigen regelmäßig ein Smartphone – trotzdem geben viele Kinder an, Inhalte nur schwer einordnen zu können oder unsicher zu sein, was im Netz erlaubt ist und was nicht.
Die aktuelle KIM-Studie zeigt eindrücklich, wie stark digitale Medien das Leben von Grundschulkindern bereits prägen – und wie wichtig es ist, dass Eltern den Überblick behalten. Fast jedes zweite Kind zwischen 6 und 13 Jahren besitzt inzwischen ein eigenes Smartphone (46 %). Bei den 12- bis 13-Jährigen sind es sogar 79 %. Und die Geräte sind längst nicht nur für Notfälle da: Sie begleiten den gesamten Alltag – von morgens bis abends.
Ein internationales Forschungsteam hat in Zusammenarbeit mit Nike den Report „Designed to Move“ veröffentlicht. Darin wird ein Zusammenhang deutlich, der Eltern nachdenklich machen darf: Kinder, die sich zu wenig bewegen, verlieren im Schnitt bis zu fünf Lebensjahre.
Was lange als politisch kaum durchsetzbar galt, wird in Großbritannien seit wenigen Tagen offen diskutiert. Ein gesetzliches Verbot von Social Media für unter 16-Jährige ist erstmals nicht mehr ausgeschlossen. Premierminister Keir Starmer erklärte in dieser Woche im Parlament, man sei offen dafür, das australische Modell genau zu prüfen. Ein fertiges Gesetz gibt es nicht. Aber der politische Ton hat sich spürbar verändert.
Indonesien hat den KI-Chatbot Grok vorübergehend blockiert. Damit ist das Land das erste weltweit, das den Zugang zu diesem KI-System offiziell einschränkt. Der Schritt ist eine Reaktion auf massive Vorwürfe rund um sexualisierte Deepfake-Bilder, die mithilfe der KI erstellt werden konnten. Besonders brisant ist dabei, dass auch Darstellungen von Minderjährigen betroffen gewesen sein sollen.
Was passiert, wenn Jugendliche freiwillig für drei Wochen auf ihr Smartphone verzichten? Nicht für ein paar Stunden. Nicht für einen Projekttag. Sondern für 21 Tage am Stück. Genau dieses Experiment hat Fabian Scheck mit seinen Schülerinnen und Schülern gewagt und damit etwas ausgelöst, das weit über eine einzelne Klasse hinausgeht. Aus einem freiwilligen Selbstversuch wurde eine landesweite Bewegung. Und eine der eindrücklichsten Erfahrungen, die derzeit zeigen, wie tief Smartphones bereits in das Leben junger Menschen eingreifen.
Manche Gespräche entstehen nicht geplant, sondern weil Menschen ähnliche Fragen beschäftigen. So war es auch hier. Jerome Braun hatte mich angerufen, nachdem er immer häufiger über Artikel von Medienzeit gestolpert war. Er wollte verstehen, was wir machen, warum wir das machen, wo das alles herkommt und was aus unserer Sicht noch kommen muss. Aus diesem ersten Austausch ist schließlich eine ganze Podcastfolge entstanden.
Die Diskussion um ein Handy-Verbot für Kinder ist laut. Und sie wird emotional geführt. Zwischen dem Wunsch nach Schutz und der Sorge vor Bevormundung stehen viele Eltern ratlos da. Was hilft wirklich Was schadet und was lenkt vom eigentlichen Problem ab. Es fehlt oft Orientierung. Darf man verbieten, sollte man verbieten oder macht man es damit nur schlimmer?
Die Adventszeit bringt in vielen Familien etwas zurück, das im Alltag oft untergeht. Es wird ein wenig ruhiger, man sitzt näher zusammen, Kinder suchen häufiger Nähe und erzählen mehr. Genau in dieser Stimmung merken viele Eltern, was ihren Kindern wirklich gut tut und wo sie sich manchmal etwas mehr Halt wünschen. In diesem Gefühl möchten wir ansetzen. Nicht mit einer Kampagne und nicht mit großen Worten, sondern mit einem kleinen gemeinsamen Zeichen.
Die Diskussion über ein mögliches Social Media-Verbot für Kinder wird in Deutschland oft entlang bekannter Linien geführt. Es geht um Medienkompetenz, um Teilhabe, um pädagogische Begleitung und um die Frage, wie viel Regulierung nötig ist. Doch diese Sicht greift zu kurz, weil sie einen zentralen Punkt übersieht: Digitale Räume sind keine neutralen Orte. Gerade deshalb lohnt sich der Blick auf die Analyse der LFK.
Wann ist der richtige Zeitpunkt für ein eigenes Smartphone. Wie viele Regeln brauchen Kinder. Und wo endet Vertrauen. Diese Fragen bewegen aktuell viele Familien. Die Märkische Allgemeine Zeitung greift dieses Spannungsfeld in einem aktuellen Artikel auf und stellt zwei sehr unterschiedliche elterliche Haltungen gegenüber.
In Brasilien gilt seit Anfang 2025 ein neues Gesetz, das die private Nutzung von Smartphones an allen Schulen verbietet. Während des Unterrichts, in Pausen und auf dem ganzen Schulgelände dürfen Kinder ihre Geräte nicht mehr benutzen. Nur für Unterrichtsaufgaben, gesundheitliche Gründe oder Notfälle gibt es Ausnahmen. Die Idee dahinter ist simpel und sehr vertraut: Kinder sollen lernen können, ohne ständig von Social Media, Chats und Spielen aus ihrem Fokus gerissen zu werden.
Kinder brauchen Schutzräume. Das klingt selbstverständlich, ist in vielen Schulen aber längst eine tägliche Herausforderung. Der Tagesspiegel berichtet jetzt über die Forderung der Landesärztekammer Brandenburg nach einem grundsätzlichen Handyverbot an Schulen. Wir sind darauf sehr stolz, denn den Impuls für diese Forderung setzen wir mit “Medienzeit” bei einem Vortrag letzten Samstag gemeinsam mit der medizinischen Einordnung von Dr. Steven Rohbeck.
Die Landesärztekammer Brandenburg fordert ein Handyverbot an Schulen, flächendeckend und verbindlich geregelt, insbesondere in Pausen und außerhalb des Unterrichts. Darüber hinaus braucht es klare gesetzliche Regelungen zur Medien- und Plattformnutzung für Minderjährige, bundesweite Aufklärungskampagnen, die Eltern, Schulen und Jugendliche über Risiken, Prävention und gesunde Mediennutzung informieren sowie eine Stärkung der Präventionsprogramme in Kitas, Schulen und Jugendeinrichtungen.
Der Fall White Tiger hat viele Familien tief erschüttert. Ein junger Mann aus Hamburg soll Kinder und Jugendliche online manipuliert und in den Suizid getrieben haben, darunter ein 13 jähriger Junge aus den USA, der seinen Tod live streamte. Doch dieser Fall ist nur ein Bruchstück eines viel größeren Problems. Hinter White Tiger steht eine digitale Szene, die sich unter den Namen „Com“ und „764“ bewegt und deren Ziel es ist, Macht über maximal verletzliche Jugendliche zu gewinnen. Eltern müssen verstehen, wie diese Gruppen funktionieren und warum sie so effektiv darin sind, Kinder psychisch zu zerstören.
Stand 26. November 2025: An diesem Tag hat das Europäische Parlament einen weitreichenden Beschluss gefasst. Die Abgeordneten fordern strengere Regeln zum Schutz Minderjähriger im Netz. Social Media, Videoportale und KI Assistenten sollen erst ab 16 frei zugänglich sein. Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren sollen diese Dienste nur nutzen dürfen, wenn Eltern ausdrücklich zustimmen. Der Beschluss stellt nicht nur die Frage, ab welchem Alter Kinder Plattformen nutzen dürfen. Er stellt auch die Frage, wie Plattformen überhaupt für junge Nutzer gestaltet sein dürfen.
Manchmal gibt es politische Entscheidungen, die weit über ein Land hinaus wirken. Der neue Beschluss in Australien gehört genau dazu. Dort gilt ab dem 10. Dezember ein Gesetz, das Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren den Zugang zu bestimmten Social Media Angeboten verwehrt. Unter 16 Jahren darf man diese Dienste nicht mehr nutzen. Und plötzlich zeigt sich, dass konsequente Regeln etwas verändern können.
Wir empfehlen dieses Video ausdrücklich. Es zeigt eine Runde, die selten geworden ist. Menschen sprechen miteinander. Respektvoll, informiert und auf Augenhöhe. Und mittendrin eine der stärksten Stimmen in Deutschland, wenn es um Kinder und digitale Sicherheit geht: Silke Müller. Die Folge zeigt eindrücklich, wie eine faire und ernsthafte Auseinandersetzung mit diesem Thema aussehen kann. Nicht als Schlagabtausch, sondern als ehrliche Suche nach Lösungen für Kinder, Schulen und Familien.
Wen wir richtig gut finden.
Es gibt Themen, bei denen Wegschauen keine Option ist. Sexualisierte Gewalt gehört dazu. Alena Mess arbeitet seit über zwanzig Jahren genau in diesem Feld. Dort, wo es weh tut hinzuschauen. Dort, wo Klarheit wichtiger ist als Beruhigung. Sie weiß, wovon sie spricht. Nicht aus Theorie, sondern aus jahrzehntelanger Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Familien, Betroffenen und Tätern.
Digitale Medien sind längst Teil des Alltags von Kindern und Jugendlichen. Sie prägen Beziehungen, Selbstwahrnehmung und Entwicklung. Barbara Unterholzner beschäftigt sich seit über zwanzig Jahren mit der Frage, wie digitale Entwicklungen auf Menschen wirken und was Kinder wirklich brauchen, um psychisch und körperlich gesund aufzuwachsen.
Dr. Julia Freudenberg ist eine Frau, die Dinge in Bewegung bringt. Wer ihr zuhört, merkt schnell, dass es ihr nicht um Technik an sich geht. Es geht ihr um Kinder. Um die Frage, wie junge Menschen in einer digitalen Welt Orientierung finden können, ohne überfordert zu werden, und wie Bildung ihnen Sicherheit und Selbstvertrauen gibt.
Julia von Weiler gehört zu den Menschen, die den Kinderschutz in Deutschland über Jahrzehnte geprägt haben. Seit Anfang der neunziger Jahre arbeitet sie unermüdlich daran, Kinder und Jugendliche besser zu schützen und die Öffentlichkeit über sexualisierte Gewalt und digitale Risiken aufzuklären. Sie war eine der ersten Stimmen, die früh erkannten, wie sich Übergriffe und Manipulation ins Internet verlagern und welche neuen Antworten Kinder und Familien brauchen.
Kinder und Jugendliche verbringen oft viele Stunden am Tag im digitalen Raum. Sie sehen Inhalte, die sie überfordern, sie berichten von brutalen Videos, von Nacktbildern, Fremdkontakten, Druck und Abhängigkeiten. Genau hier setzt Maja Sommer an. Ihr Ziel ist klar. Kinder sollen sich sicherer fühlen, kritischer werden, sich selbst besser schützen können und wieder mehr echte Momente erleben.
Es gibt Menschen, die reden über digitale Risiken. Und es gibt Menschen, die jeden Tag damit arbeiten und Kindern, Jugendlichen und Eltern ganz konkret helfen. Gesa Gräfin von Schwerin gehört seit vielen Jahren zu den wichtigsten Stimmen im deutschsprachigen Raum, wenn es um Schutz vor digitaler Gewalt geht. Mit Law4School erreicht sie Schulen in ganz Deutschland mit Live Webinaren, Elternabenden und Angeboten für Klassen.
Varvara Herbst kennt die Realität von Familien sehr genau. Ein voller Alltag, kaum Pausen, viel Verantwortung und digitale Themen, die zusätzlich Stress erzeugen. Sie weiß, wie dünn die Nerven werden können, wenn ein Kind nicht aufhört zu scrollen, wenn ein Konflikt eskaliert oder wenn man selbst keine Energie mehr hat. Was sie besonders macht: Varvara erklärt psychologische Zusammenhänge so, dass Eltern sich darin wiedererkennen. Ohne Fremdwörter, ohne Schwere, ohne Belehrung. Sie spricht so, wie man sprechen muss, wenn Menschen gerade wenig Kapazität haben. Klar, warm, verständlich.
Wenn Kinder heute in die digitale Welt eintauchen, sind wir Eltern oft hin- und hergerissen: Einerseits wollen wir sie schützen. Andererseits wollen wir nicht die sein, die alles verbieten. Und irgendwo dazwischen liegt die Realität – mit Gruppenchats, Memes, TikTok-Trends und Nächten, in denen das Handy unter der Bettdecke weiterleuchtet.
Genau hier setzt Daniel Wolff an. Er ist Medienpädagoge, Vater von drei Kindern und seit Jahren an Schulen unterwegs. Er spricht mit Eltern, die sich sorgen, und mit Jugendlichen, die längst in einer Welt leben, die wir oft nur aus zweiter Hand kennen. Und: Er redet so, dass man ihm zuhört.
Auch an der Goethe-Grundschule hören wir Sätze wie „Ich habe Angst vor YouTube“, „Ich finde abends den Aus Knopf nicht mehr“, „Ich habe das ganze Wochenende gezockt“ oder „Mir hat jemand ein Nacktbild geschickt und ich kenne den nicht“. Die Rückmeldungen aus allen Jahrgangsstufen zeigen, dass die Risiken real sind. Direktorin Anja Henkes nimmt nun Medienbildung in den Fokus: Aufklärung für Kollegium und Eltern, eine Steuergruppe für Medienkompetenz, Sprechstunden, Achtsamkeit im Unterricht und kreative Projekte mit den Kindern.
Wir wollen, dass unsere Kinder sicher groß werden, offline und online. In der Realität prasseln Chats, DMs, Livestreams und In-Game-Nachrichten auf sie ein. Fremde schreiben „Hey, wie alt bist du?“ oder „Schick mal ein Bild“. Genau an dieser Schnittstelle arbeitet jemand, der Klartext redet und konkrete Lösungen anbietet: Thomas-Gabriel Rüdiger, Kriminologe mit Professur und Leiter des Instituts für Cyberkriminologie an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg.
Sag es weiter!
Es beginnt alles mit einer Idee – und sie wächst, wenn Menschen darüber sprechen. Erzähle Freundinnen und Freunden, Bekannten oder in deiner Schule und Kita von Medienzeit. Teile unsere Beiträge in sozialen Netzwerken oder schicke sie an andere Eltern, die von unseren Inhalten profitieren könnten.
Jede Empfehlung macht einen Unterschied und hilft, dass immer mehr Familien von Medienzeit erfahren. Gemeinsam können wir etwas bewegen.
Häufig gestellte Fragen.
-
Ab welchem Alter sollte mein Kind ein Smartphone haben?
Die meisten Expert:innen empfehlen, so spät wie möglich. Oft ist ein eigenes Smartphone ab 12 Jahren sinnvoll – wenn Kinder schon sicher im Umgang mit Medien sind.
-
Wie viel Bildschirmzeit ist in welchem Alter noch okay?
Das hängt vom Alter und der Situation ab. Für Grundschulkinder sind maximal 30–60 Minuten am Tag eine gute Grenze, für Jugendliche kann es mehr sein – wichtig sind klare Absprachen und feste Pausen. In vielen Familien gibt es Medienzeiten auch nur am Wochenende und nicht unter der (Schul-)Woche.
-
Helfen Kindersicherungen wirklich?
Kindersicherungen sind nützlich, aber nicht wasserdicht. Kinder finden oft Wege, Sperren zu umgehen. Entscheidend bleibt das Gespräch und gemeinsame Regeln.
-
Ab wann sollte mein Kind Social Media nutzen?
Je später, desto besser. Offiziell sind Plattformen wie TikTok, Instagram oder Snapchat ab 13 Jahren freigegeben – doch die Altersgrenzen sind leicht zu umgehen und bieten keinen echten Schutz. In der Praxis zeigen Studien, dass frühe Nutzung oft mit höherem Risiko für Suchtverhalten, Cybermobbing oder problematische Inhalte verbunden ist. Eltern sollten Social Media deshalb so lange wie möglich hinauszögern und Kinder erst dann starten lassen, wenn sie reif genug sind, Risiken zu verstehen und über Erlebnisse offen zu sprechen.
-
Ist TikTok gefährlich für Kinder?
TikTok kann Spaß machen, birgt aber sehr viele Risiken: problematische Inhalte, Datenmissbrauch, Suchtfaktor. Eltern sollten die App gemeinsam mit Kindern ausprobieren und klare Regeln festlegen. Grundsätzlich: Mit Social Media so spät wie möglich starten.
-
Soll ich meinem Kind Instagram erlauben?
Instagram ist offiziell ab 13 Jahren freigegeben. Ob es passt, hängt von der Reife deines Kindes ab. Begleite den Einstieg aktiv und sprich über problematische Inhalte. Auch für Instagram gilt: Social Media so lange wir möglich rauszögern.
-
Was ist so schlimm an Spielen wie Fortnite oder Roblox?
Sie können Spaß machen, bergen aber auch Risiken wie hohe Bildschirmzeit, In-App-Käufe oder Kontakt mit Fremden. Wir haben etliche Artikel zu Spielen verfasst, die eine Orientierung geben. Wichtig ist eine gute Balance zwischen Spielen und Offline-Zeit.
-
Wie erkenne ich, ob mein Kind spielsüchtig wird?
Warnzeichen sind Rückzug, Reizbarkeit ohne Spiele oder vernachlässigte Hobbys. Wenn das Spiel das Leben deines Kindes bestimmt, ist Handeln nötig.
-
Welche Spiele sind für Kinder empfehlenswert?
Die USK-Altersfreigaben wirken oft wie eine Orientierung – tatsächlich bringen sie Eltern aber wenig. Denn: Die Spielehersteller reichen ihre Games selbst zur Prüfung ein, es gibt keine unabhängige Bewertung der Inhalte im Alltag. Eltern sollten deshalb nicht blind auf das USK-Logo vertrauen, sondern selbst schauen, welche Spiele geeignet sind. Beliebt und meist unproblematisch sind Offline-Titel wie z. B. viele „Super Mario“-Titel.
-
Wie kann ich Cybermobbing erkennen und was kann ich tun?
Achte auf Veränderungen im Verhalten: Rückzug, Traurigkeit oder Angst vor dem Handy. Wichtig: zuhören, ernst nehmen, mit Schule oder Beratungsstellen sprechen.
-
Was ist Cybergrooming und wie schütze ich mein Kind davor?
Dabei versuchen Erwachsene, über Chats Kontakt zu Kindern aufzubauen. Schutz: Privatsphäre-Einstellungen nutzen, Kinder sensibilisieren und offen über Risiken sprechen.
-
Wie verhindere ich, dass mein Kind auf Gewalt- oder Sex-Inhalte stößt?
Hundertprozentiger Schutz ist kaum möglich. Aber: Filter, Kindersicherungen und gemeinsame Nutzung helfen. Entscheidend ist, dass Kinder wissen, dass sie sich jederzeit an dich wenden können.
-
Soll ich die Geräte meines Kindes kontrollieren?
Kontrolle allein bringt wenig. Besser sind gemeinsame Absprachen, Vertrauen und offene Gespräche. Kinder sollten wissen, dass du im Notfall Einsicht nehmen kannst.
-
Wie spreche ich mit meinem Kind über problematische Inhalte?
Bleib ruhig, höre zu und verurteile nicht sofort. Frag nach: „Was denkst du darüber?“ So entsteht Vertrauen, statt dass dein Kind dichtmacht.
-
Welche Regeln helfen im Familienalltag?
Beliebt sind Handyfreie Zeiten (z. B. beim Essen), feste Bildschirmzeiten und klare Absprachen zur App-Nutzung. Wichtig: Regeln gelten auch für Erwachsene.




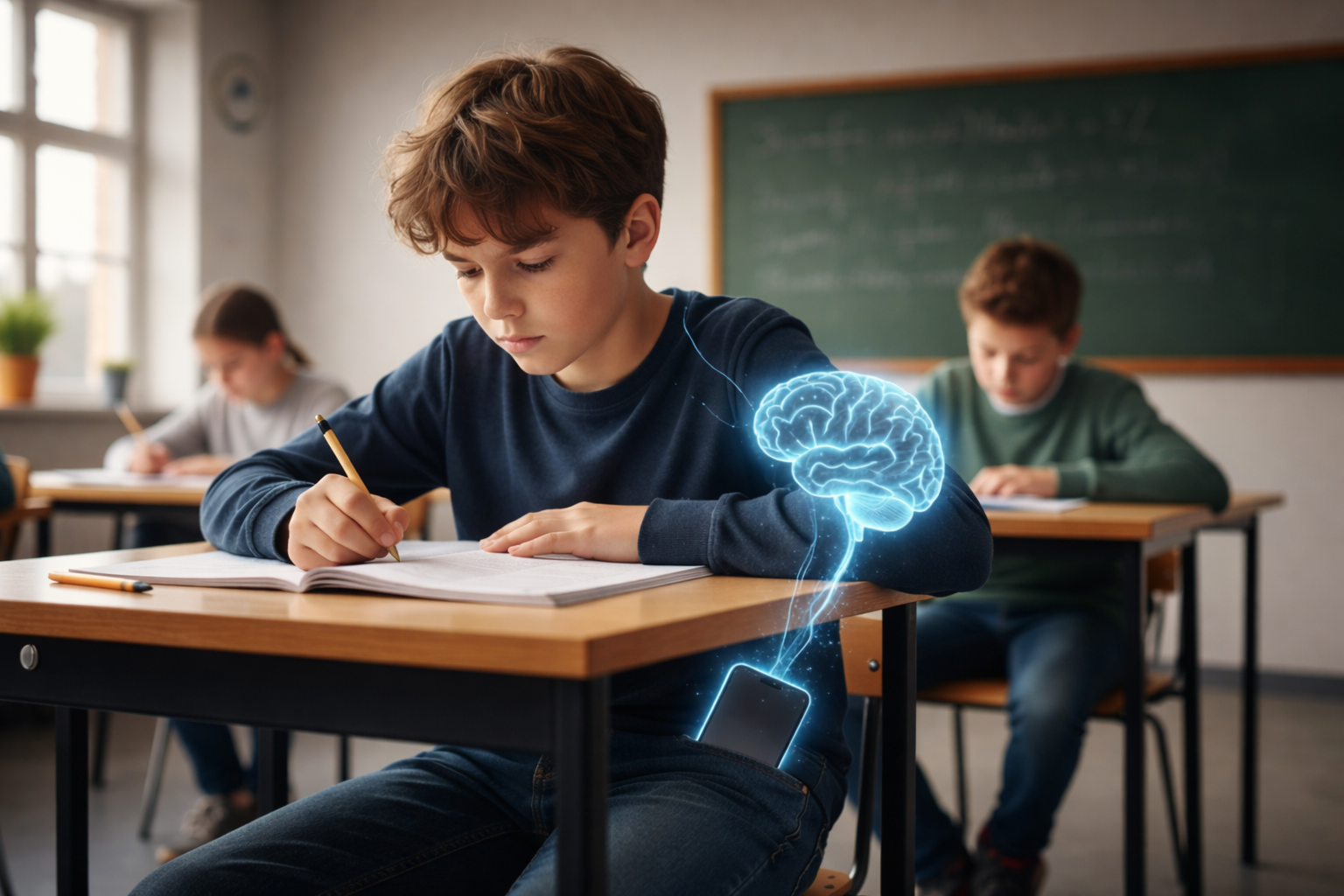








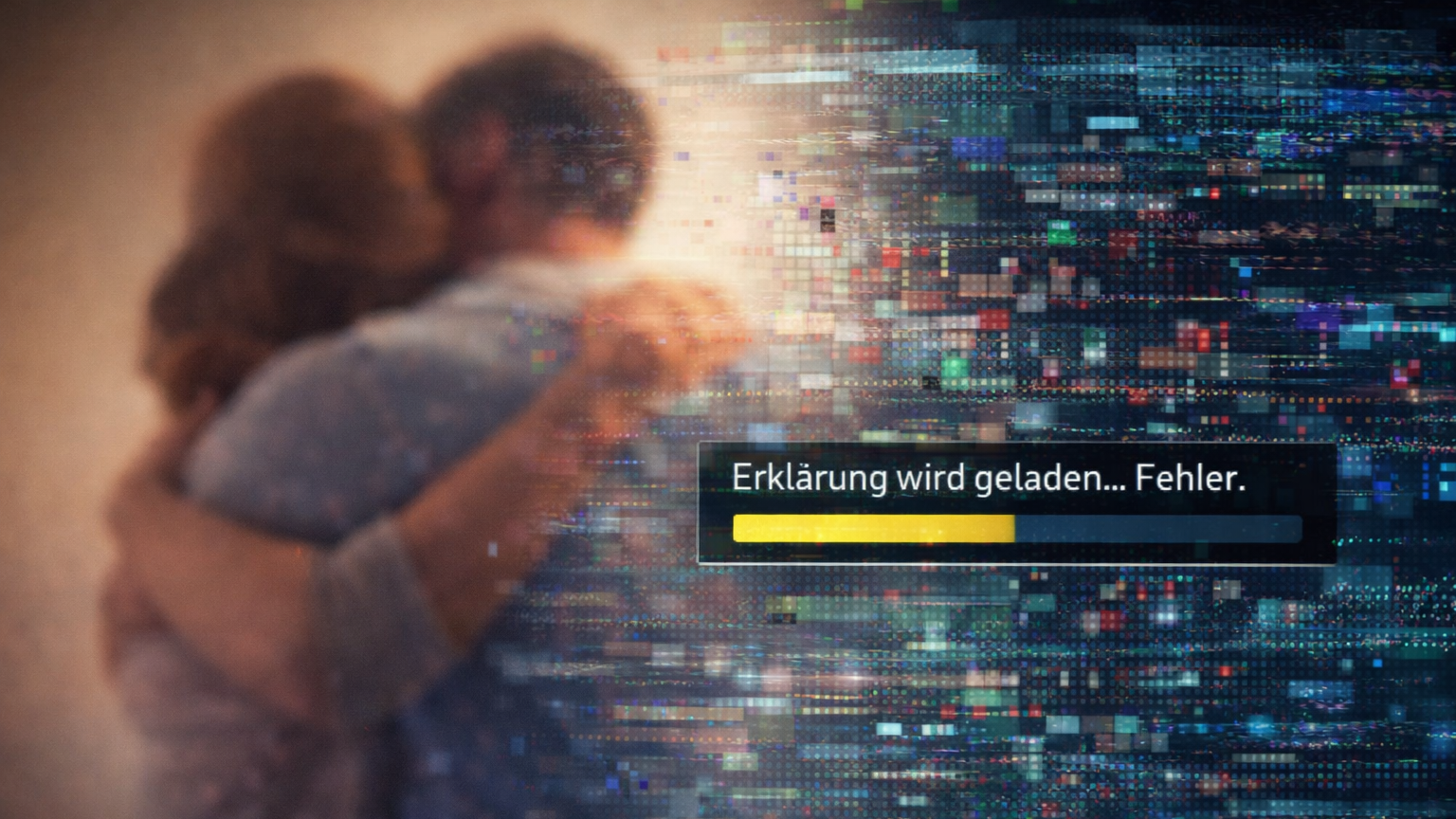























































































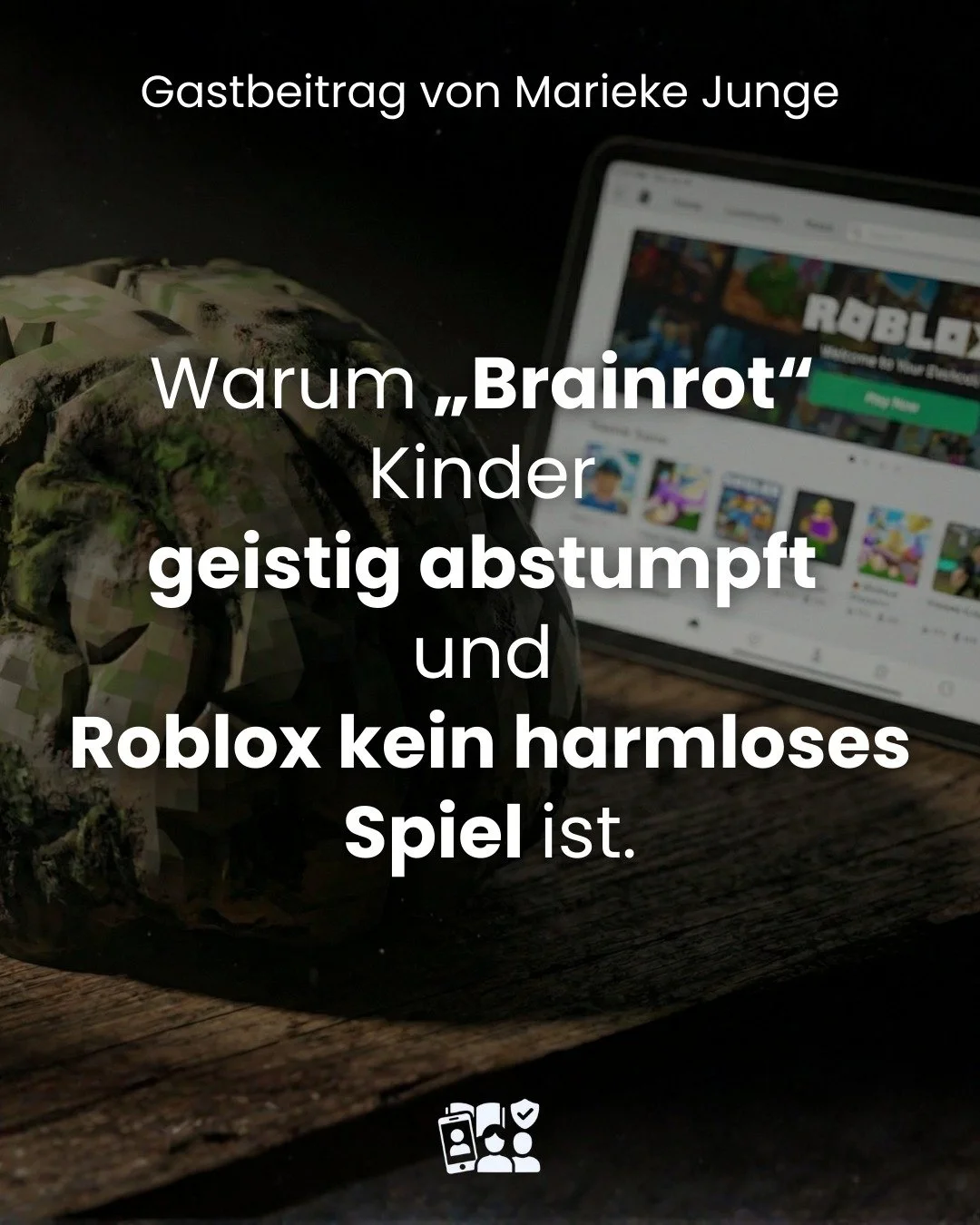



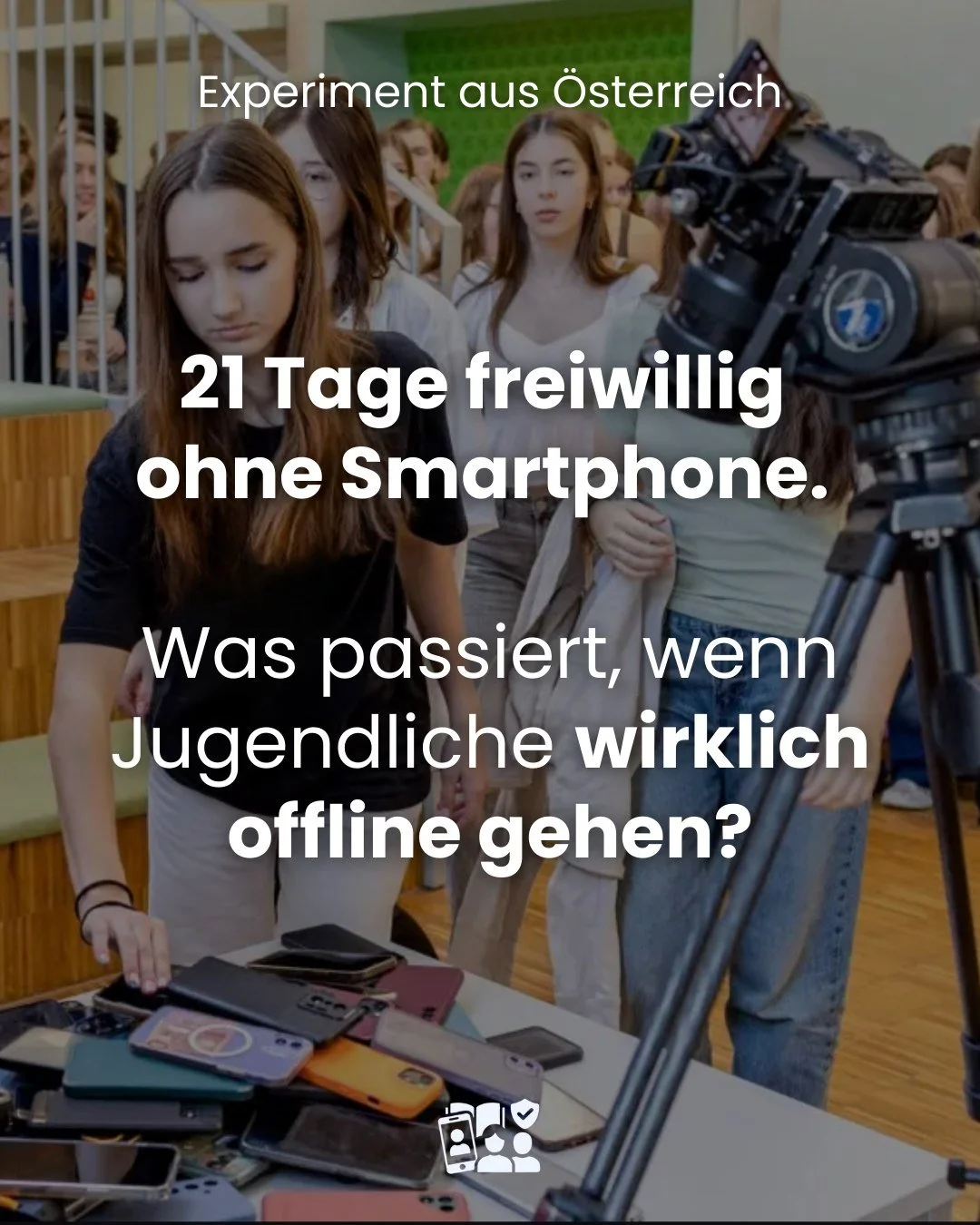


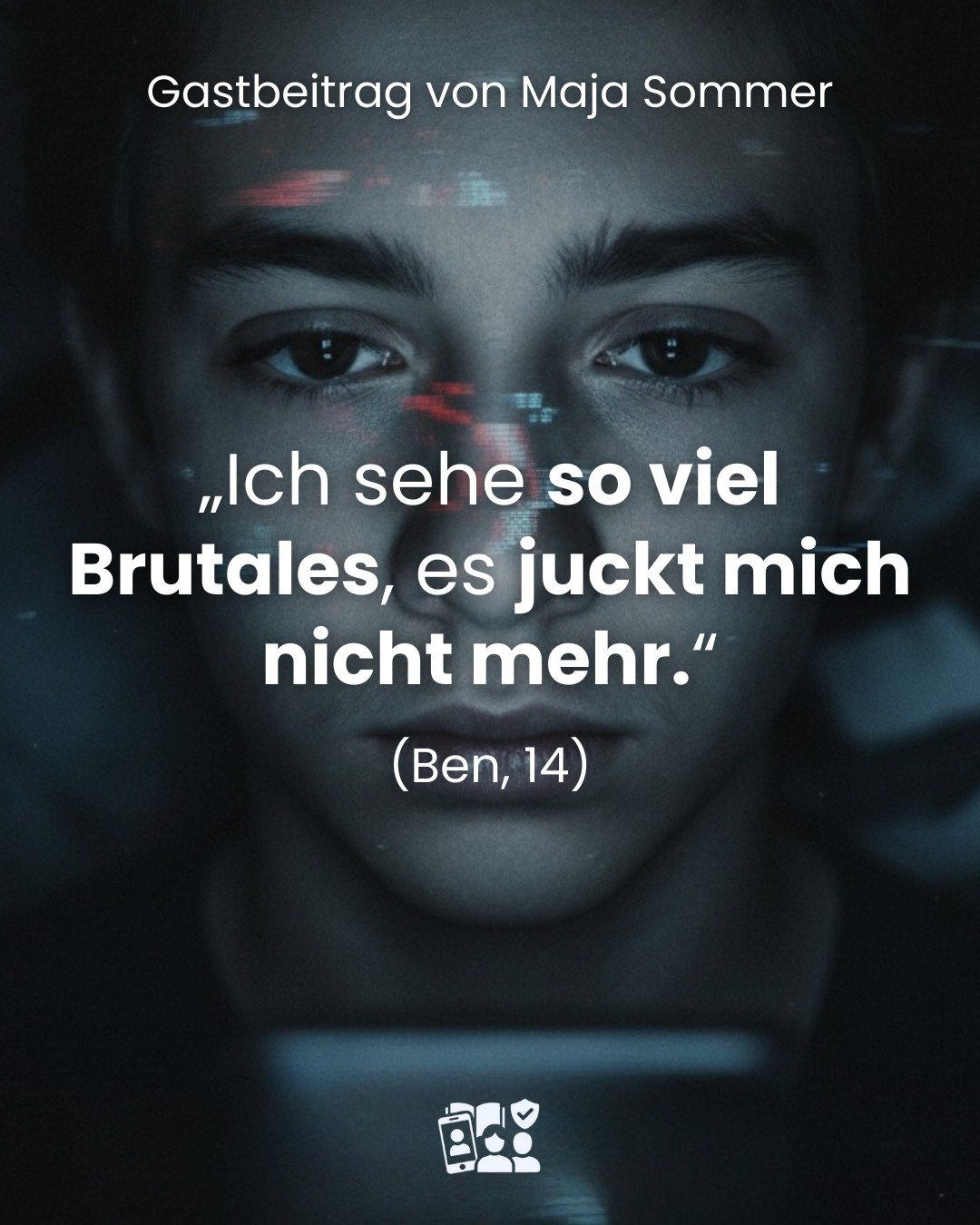
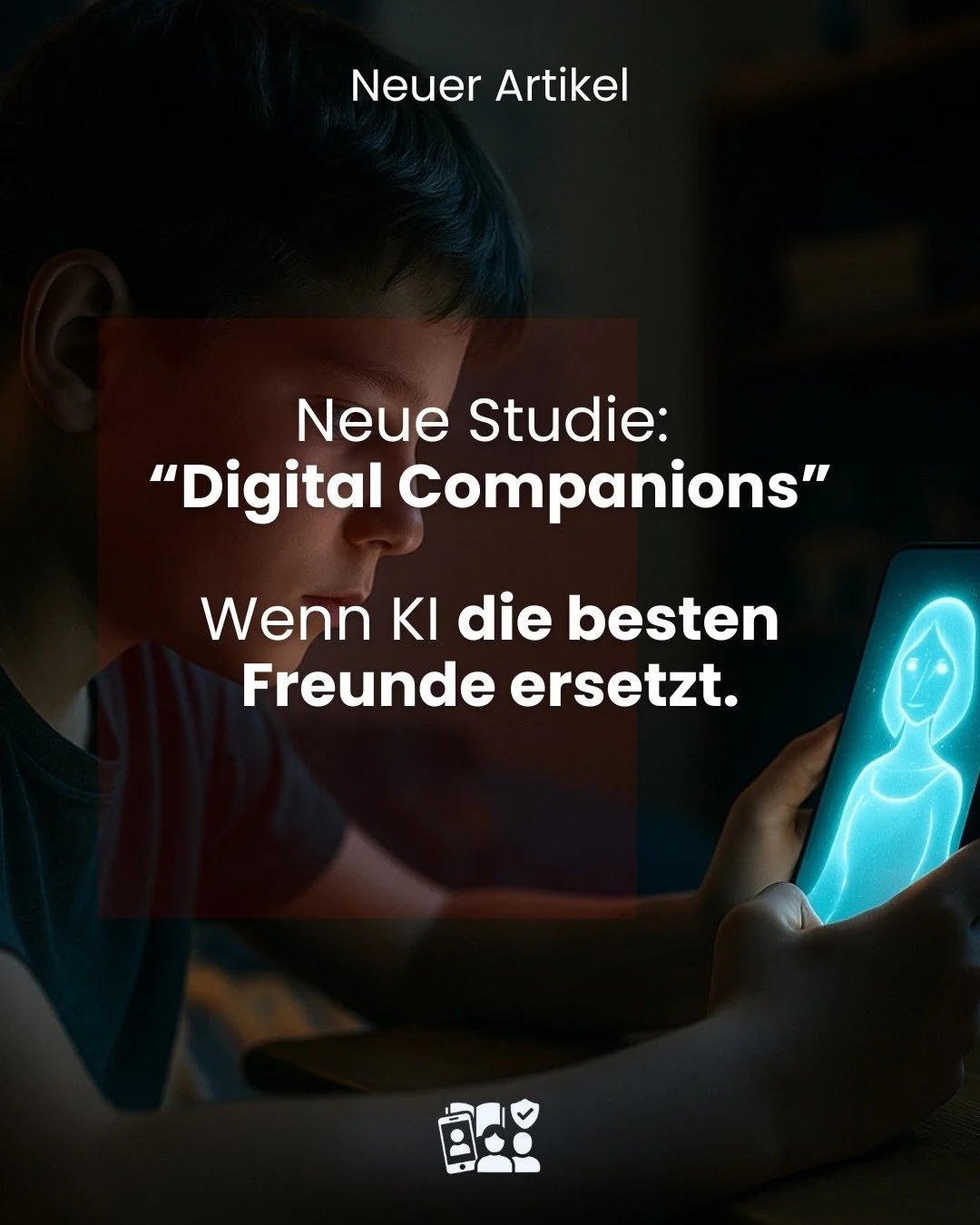

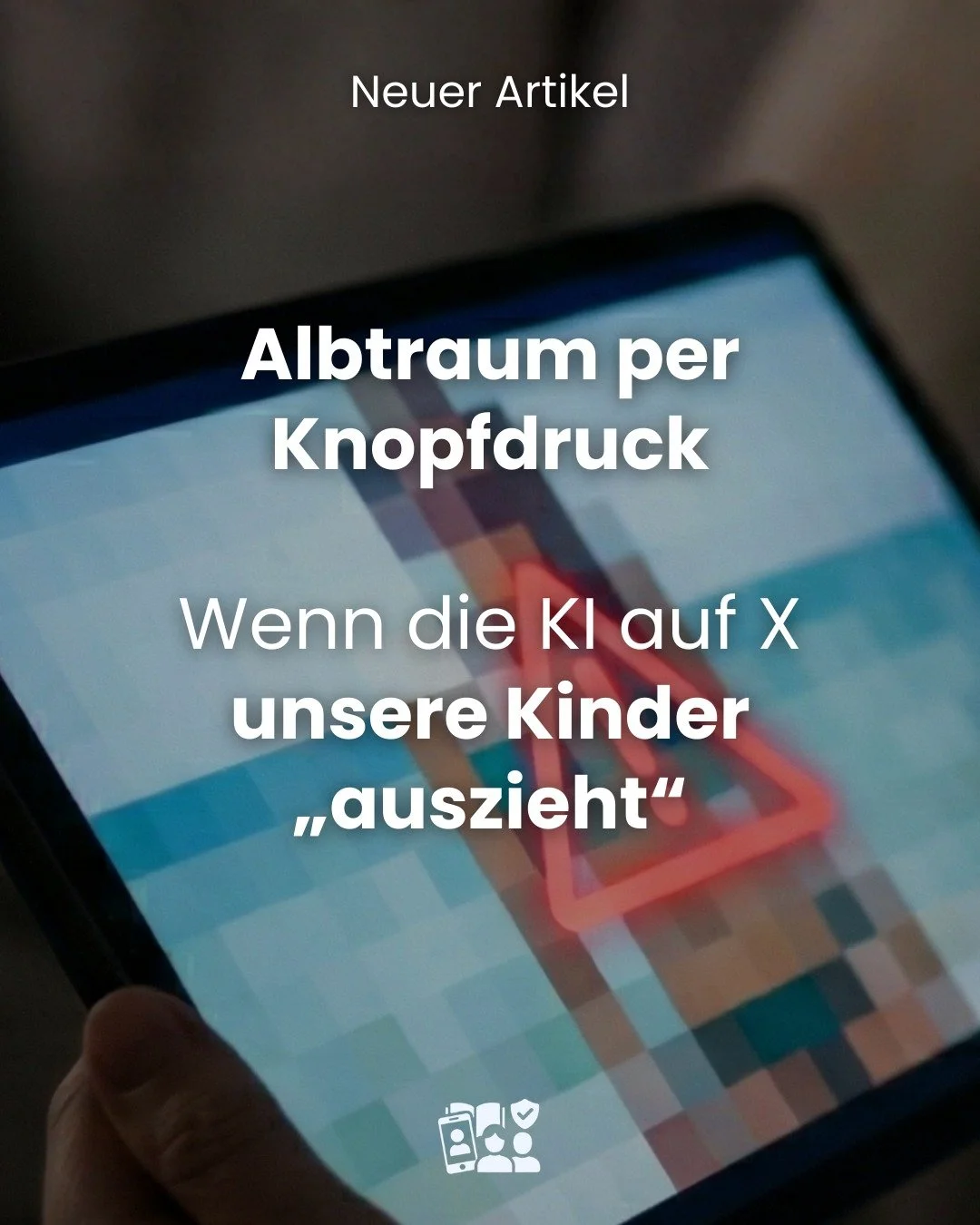

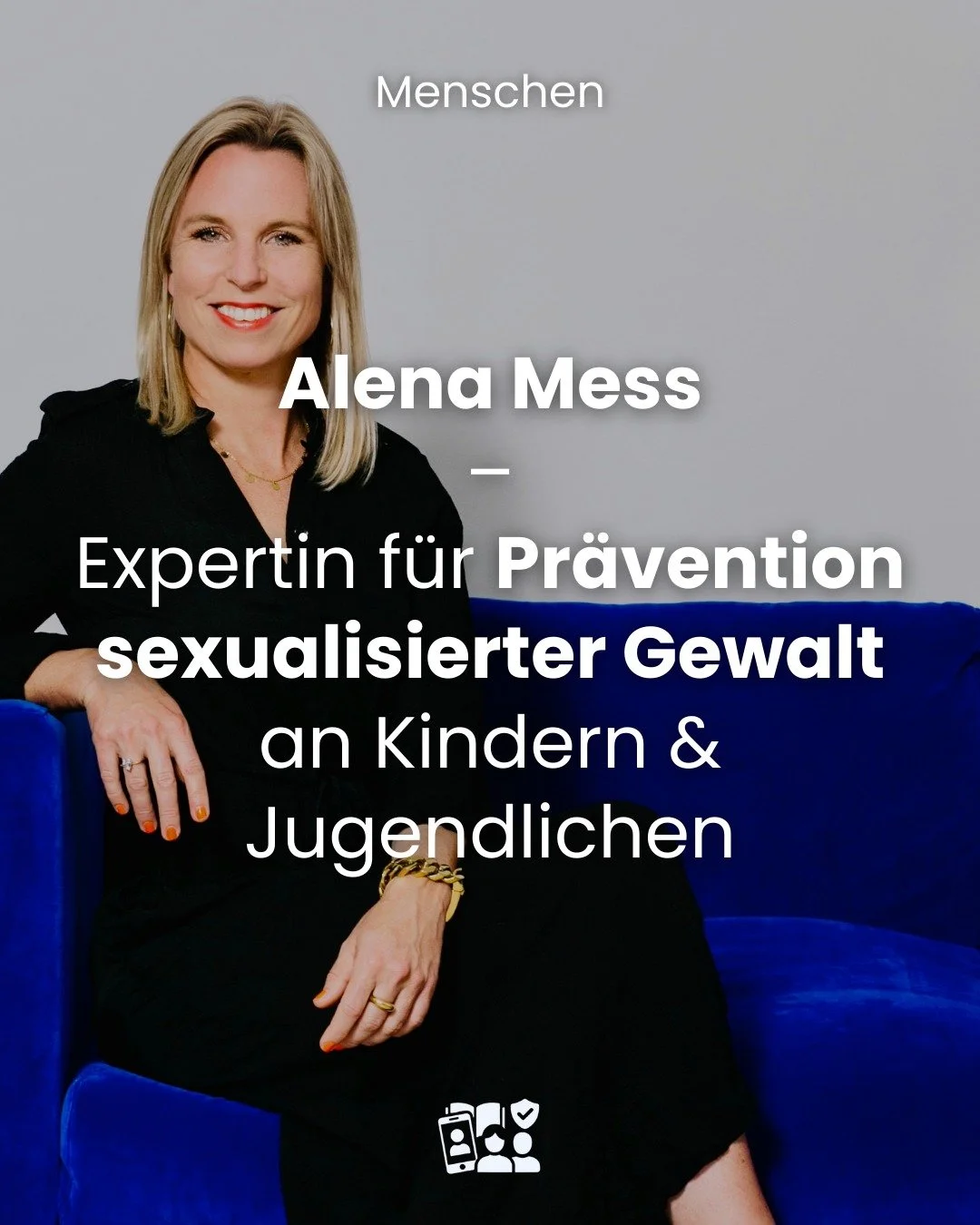
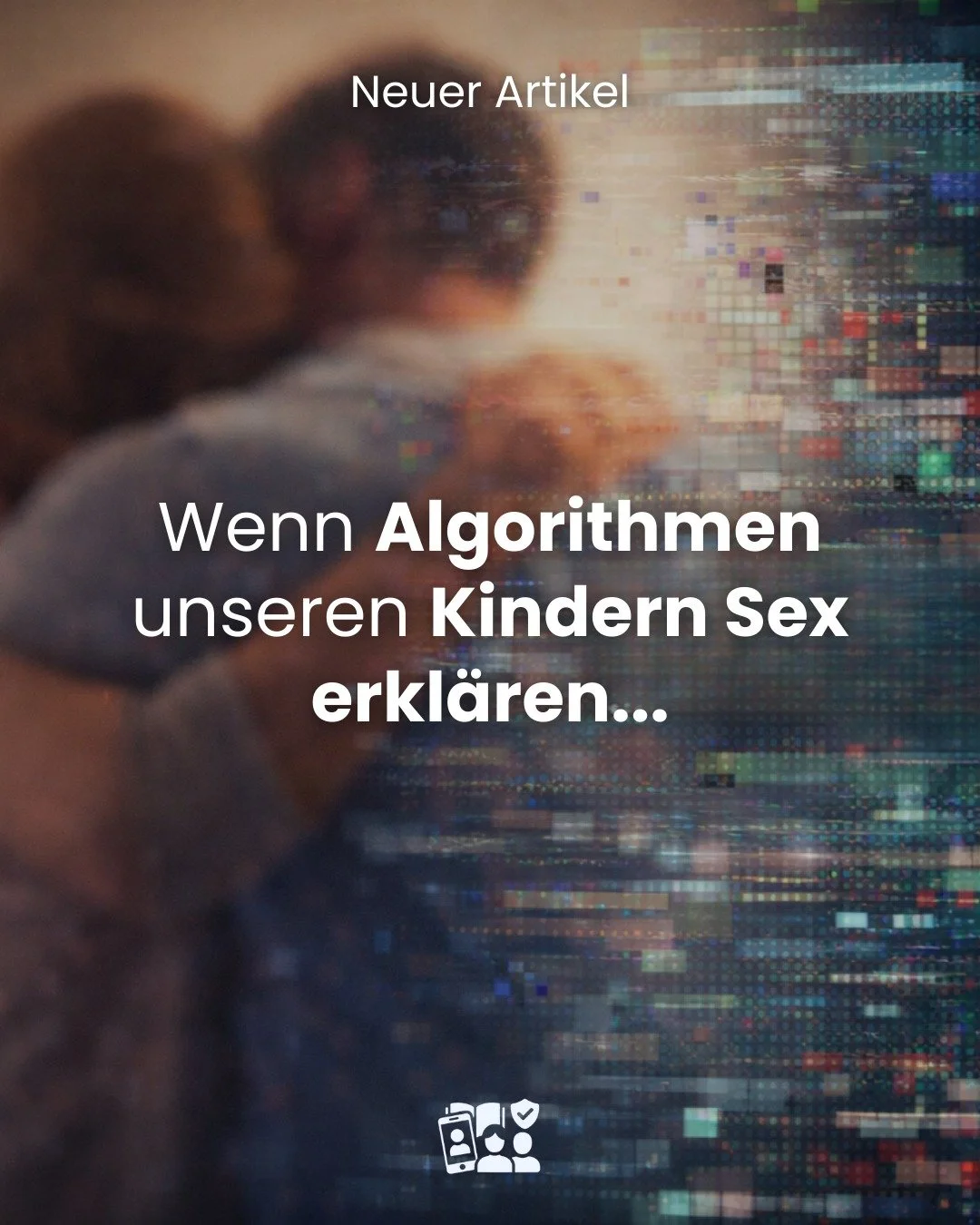




Ein Gastbeitrag von Marieke Junge
Als Mutter, Philosophin und Pädagogin schaue ich mit besonderer Aufmerksamkeit und zunehmender Sorge auf digitale Spielewelten, die sich an Kinder und Jugendliche richten. Ich bin nicht grundsätzlich gegen digitale Spiele. Aber ich bin, wie wohl viele Leserinnen und Leser hier, medienkritisch. Und ich halte es für unsere Verantwortung als Erwachsene, genauer hinzusehen, wenn Unterhaltungsindustrien beginnen, Denken, Aufmerksamkeit und Entwicklung von Kindern systematisch zu kontrollieren.